Klimakiller Wirtschaft
Messung der Umweltperformance dringend notwendig
Hinter vorgehaltener Hand verraten deutsche Regierungsteilnehmer der Klimaschutzverhandlungen in Paris: „Wenn Unternehmen wüssten, welche Konsequenzen die dort unterschriebenen Verträge langfristig haben, würden sie lieber heute als Morgen erste Maßnahmen ergreifen …" forum sprach dazu mit dem Klimaexperten Jochen Knobloch.
Herr Knobloch, was hat sich seit dem Klimaabkommen von Paris getan?
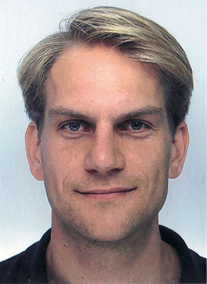 Einige Unternehmen haben erkannt, dass am Klimaschutz kein Weg vorbeiführt und nutzen diese Einsicht, um sich als Vorreiter im Klimaschutz zu positionieren. Auch regulatorische Anforderungen werden steigen. Die EU hat mit der „CSR-Richtlinie" einen Gesetzentwurf mit konkreten Anforderungen an Unternehmen auf den Weg gebracht. Diese sollen bereits ab 2017 in Kraft treten. Davon betroffen sind kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen mit mehr als 500 MA und mehr als 40 Millionen EUR Umsatz. Indirekt betroffen sind auch kleinere Betriebe, wenn sie Vorlieferanten von größeren Unternehmen sind. Grundsätzlich werden nichtfinanzielle Aspekte immer stärker gewichtet und sollten daher von Unternehmen schon heute gemessen und in Kennzahlen erhoben werden
Einige Unternehmen haben erkannt, dass am Klimaschutz kein Weg vorbeiführt und nutzen diese Einsicht, um sich als Vorreiter im Klimaschutz zu positionieren. Auch regulatorische Anforderungen werden steigen. Die EU hat mit der „CSR-Richtlinie" einen Gesetzentwurf mit konkreten Anforderungen an Unternehmen auf den Weg gebracht. Diese sollen bereits ab 2017 in Kraft treten. Davon betroffen sind kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften, Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen mit mehr als 500 MA und mehr als 40 Millionen EUR Umsatz. Indirekt betroffen sind auch kleinere Betriebe, wenn sie Vorlieferanten von größeren Unternehmen sind. Grundsätzlich werden nichtfinanzielle Aspekte immer stärker gewichtet und sollten daher von Unternehmen schon heute gemessen und in Kennzahlen erhoben werden
Was können Firmen tun, um rechtzeitig und gut aufgestellt zu sein?
Der erste und wichtigste Schritt ist, neben der Entschlossenheit, den Klimaschutz ernst zu nehmen und endlich zu handeln, die Kennzahlenerhebung, denn nur was gemessen wird, kann auch gesteuert werden. Jochen Zeitz erkannte das bereits in seiner Zeit als CEO bei Puma, als er forderte „only what you can measure, you can manage" und in seinem Unternehmen ein Zahlenwerk aufbauen ließ, das den Naturverbrauch und den Einfluss auf die Natur in Kennzahlen erfasste. Durch eine solche betriebliche Umweltkennzahlenerhebung kann festgestellt werden, wo das Unternehmen welchen Impact auf die Umwelt ausübt. Das zeigt, wo die Carbon Risks des Unternehmens liegen, welche Bereiche besonders emissionsintensiv sind und wo die Möglichkeiten zu Veränderung liegen.
Aber diese Veränderungen erfordern hohe Investitionen …
Ja und Nein! Als erstes werden durch die Zahlenerhebung Möglichkeiten zur Kostenoptimierung aufgedeckt, oft sogar ohne größere Investitionen. Die zweite Aufgabenstellung lautet: Wo liegt Optimierungspotenzial mit Investitionen in Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und neues Produktdesign? Über die Definition von Zielen und die Aufstellung von Key Performance Indicators (KPIs), wird eine neue strategische Ausrichtung mess- und steuerbar und führt über Benchmarking nicht nur zu einem kontinuierlichen Optimierungsprozess, sondern gibt auch Möglichkeiten zu einer Verbesserung der Stakeholderkommunikation.
Welche Kennzahlen müssen dazu ermittelt werden?
Bei der Erhebung von Treibhausgasemissionen ist es wichtig, nicht nur die direkten Emissionen des Unternehmens zu betrachten. Vielmehr müssen auch Werte aus der Lieferkette herangezogen werden, also Emissionen, die bei der Erzeugung von Rohstoffen, Vorprodukten oder Dienstleistungen entstehen, welche durch das Unternehmen genutzt werden. Dazu gehören auch der Geschäftsreiseverkehr und die Logistik außerhalb der eigenen Firmenflotte. Diese sogenannten Scope-3-Emissionen in vorgelagerten Prozessen bei Lieferanten sowie nachgelagerten Prozessen bei der Entsorgung haben einen wesentlichen Einfluss auf den gesamten Corporate Carbon Footprint (CCF) des Unternehmens.
Wie funktioniert das genau?
Mit dem CCF können Nachhaltigkeitsverantwortliche alle CO2-relevanten Aktivitäten und Verbräuche aus den Bereichen Energie, Transport, Geschäftsverkehr, Mitarbeitermobilität, Büromaterialien, Verpflegung und Abfälle erheben und bewerten lassen. Hier wird z.B. der Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden pro Energieträger durch spezifische Emissionsfaktoren in Treibhausgasemissionen umgerechnet. Die Werte werden i.d.R. in Tonnen CO2- Äquivalente gerechnet. Auf Grundlage dieser Daten lassen sich die Treibhausgasemissionen dann auf spezifische, aber vergleichbare Kennzahlen bringen.
Wie kann eine so umfangreiche Messung der betrieblichen Umweltperformance erfolgen?
Viele Unternehmen führen eine Umweltdatenerhebung und Auswertung noch mit Excel-Tabellen durch mit der Begründung „keine Lizenzkosten, leicht bedienbar, flexibel". Damit ist es jedoch schwierig, die Vollständigkeit der Bilanz gemäß Greenhouse Gas Protocol sicherzustellen. Die Problematik liegt darin, die Aktualität der Tabellen über alle Ebenen zu verfolgen und man kommt schnell an seine Grenzen, wenn Daten von mehreren Standorten und vielen Inputgebern konsolidiert werden sollen. Die Datenerhebung und eine ausreichende Datenqualität schafft man auf die Dauer nur durch ein Datenmanagementsystem, welches die Datenerhebung durch klar definierte Nutzervorgaben strukturiert. Wichtig ist dabei, dass die Software die eindeutige Nachvollziehbarkeit der Eingabe ermöglicht, also wer, wann, was eingetragen hat. Eine weitere Herausforderung ist es, die richtigen Emissionsfaktoren zu ermitteln. Mit einer Datenbanklösung spart man sich schnell so viel Zeit, dass sich anfallende Lizenzkosten wieder hereinspielen.
An einer softwaregestützten Datenbanklösung führt also kein Weg vorbei?
Langfristig nicht. Aber das ist noch nicht alles. Der Aufbau eines Kennzahlensystems braucht, genauso wie die Aufbereitung der Finanzkennzahlen, Zeit und vor allem das Commitment der Geschäftsführung. Nur dann bekommt man intern aus allen Abteilungen Unterstützung und kann auch auf die Lieferanten zugehen, um dort Zahlen einzuholen. Bei der Auswahl eines Kennzahlensystems sollte aber darauf geachtet werden, dass die Komplexität der Anwendung im Rahmen bleibt und Wert auf einfache Handhabung sowie intuitive Bedienbarkeit gelegt werden.
Für einen solchen Aufwand braucht es handfeste Vorteile – wo liegen diese?
Kein Berechnungsaufwand, Zeitgewinn bei der Erfassung der Umweltkennzahlen, vergleichbare Reportings auf Knopfdruck, einfaches Tracking von Key Performance Indikatoren und damit laufende Kontrolle der Nachhaltigkeitsziele und vor Allem: ein klar definiertes Umweltberichtswesen mit Zuweisung von Verantwortlichkeiten verbessert die Kommunikation zwischen den Abteilungen und mit den Lieferanten und deckt unglaublich viele Optimierungspotenziale auf.
Und, wie bereits erwähnt, dienen diese Maßnahmen der Risikovorsorge und bieten in der Stakeholderkommunikation die Möglichkeit, sich als transparentes und progressives Unternehmen darzustellen. Wer den Aufwand also frühzeitig betreibt, kann damit auch vom Imagegewinn des Pioniers profitieren. Eine Studie von PWC im Rahmen von Klimareporting.de gibt interessante Anhaltspunkte, mit wieviel Aufwand welcher Nutzen für Organisationen entsteht.
Wie geht man die ersten Schritte?
Auf alle Fälle empfiehlt sich ein 3-Stufen-Plan. Schritt 1 ist das Feststellen des Status quo: Wo stoße ich wie viele THG-Emissionen aus, was sind die größten Treiber? Also ermitteln Sie als erstes betriebsinterne Ergebnisse. Der nächste Schritt ist die Entwicklung einer Klimastrategie und übergreifender CSR-Ziele. Der dritte Schritt ist es, die Performance laufend zu messen und in einem Berichtswesen intern und extern zu dokumentieren. Wichtig ist dabei die permanente Optimierung der Prozesse und als letzte Möglichkeit die Kompensation nicht vermeidbarer Emissionen.
Wo geht die Reise hin?
Die Anwendung von Klimareporting ist nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Regionen interessant und kann ausgeweitet werden auf ein Monitoring der UN Sustainable Development Goals. Das heißt, ein Unternehmen sollte sich schon heute darüber im Klaren sein, dass es zukünftig Rechenschaft ablegen muss, welchen gesellschaftlichen Mehrwert es erwirtschaftet und welche Belastungen es dabei produziert. Dann reicht es nicht mehr, nur Gewinne zu erwirtschaften, sondern es muss nachweisen, wie und auf wessen Kosten dieser Gewinn erzielt wurde.
Herr Knobloch wir danken für das Gespräch.
Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 04/2016 - Klima, Krieg und gute Taten erschienen.
Weitere Artikel von :
Verteilnetze - Schauplatz der Energiewende
Die Verteilnetze werden in immer höherem Maße
zum entscheidenden Schauplatz der Energiewende.
Die Gründe dafür liegen sowohl in der Stromerzeugung und -einspeisung als auch im Verbrauch.
…dieses Ziel verfolgt The smarter E Europe, Europas größte Messeallianz für die Energiewirtschaft.
Im Kontext einer zukunftsfähigen Energiewelt stehen erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung sowie branchenübergreifende Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung 24/7 in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr im Fokus. forum präsentiert für Sie Themen, Highlights und Termine 2024.
Der aktuelle Kommentar von Fritz Lietsch
Auf 38,7 Milliarden Euro belaufen sich die Schulden des Chemiekonzerns Bayer. Nicht genug, dass Bayer auf aggressive Weise sein genmanipuliertes Saatgut und sein giftiges Glyphosat durchsetzt. Jetzt stellt der Konzern auch finanziell eine Bedrohung dar – wie andere Konzerne auch, deren Manager mit ihrer Machtgier die Allgemeinheit schädigen.
forum-Chefredakteur Fritz Lietsch verabschiedet sich von der COP 28
Diese Klimakonferenz war voller Widersprüche und damit ein perfektes Abbild unserer globalen Gesellschaft. Doch beginnen wir von vorne: Nach dem riesigen Zuspruch unserer täglichen Veranstaltungen in der „Bio-Villa" am Meer in Sharm el Sheik zur COP 27, waren wir nun auf der COP 28 mit unserem future economy forum Stand erstmals in der blue zone der COP vertreten.
Zukunft gestalten – Nachgefragt | Tops oder Flops in forum Nachhaltig Wirtschaften?
Seit 2007 stellt forum vielversprechende Projekte, Start-ups und Social Business-Initiativen vor. Häufig werden nur Mega Flops bekannt, wie etwa das Projekt Cargolifter, wo riesige Luftschiffe kniffelige Transportaufgaben übernehmen sollten. Nachfolgend zeigen wir die Entwicklung von mutigen Projekten, über deren Start wir schon einmal vor Jahren berichteten.

forum future economy
forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy.
- Zukunft bauen
- Frieden kultivieren
- Moor rockt!
Kaufen...
Abonnieren...
DEZ
2025
Impulse: Katrin Hansmeier, Basil Merk, Tina Teucher
online
JAN
2026
FEB
2026
Veränderung willkommen? Wie Wandel gelingen kann
90475 Nürnberg
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Politik
 Die Wahrheit in der Politik
Die Wahrheit in der PolitikChristoph Quarch betrachtet die aktuellen Realitätsverweigerungen mit Sorge
Jetzt auf forum:
FNG-Siegel: 25 Fonds der Erste Asset Management mit Bestnote ausgezeichnet
So klappt's mit den Weihnachtsgeschenken – ohne Stress und Schulden
Deutschland hat kein Geldproblem, Deutschland hat ein Skill-Problem
Zuversicht und Inspiration schenken
Ab 14.12.2025 gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für 2026
Wie verbessern Skibrillen die Sicht und Sicherheit auf den Pisten















