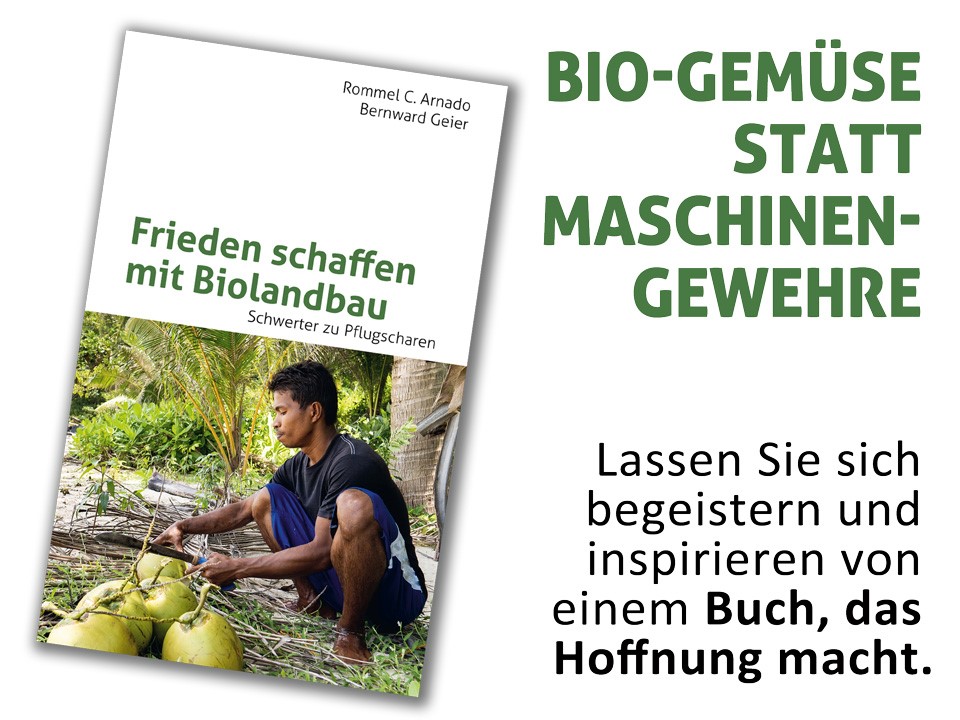Gesellschaft | WIR - Menschen im Wandel, 01.07.2015
Mit Kultur heilen
Gesundheit ist nicht etwas Äußeres, was sich quantifizieren lässt
 Es ist ein frischer Frühlingsmorgen in Hamburg. Noch treibt ein kühler Wind ein paar flache Hochnebelfelder von der Küste her übers Land, doch arbeitet sich die Morgensonne tapfer vor und schickt ein paar wärmende Strahlen in die Parkanlage von Planten und Bloomen. Ich bin mit Hartmut Schröder verabredet, dem Mann, den ich am Vorabend noch bei einem Vortrag gehört hatte und dessen Vision mich begeistert hat: die Heraufkunft einer Kulturheilkunde – ein Zauberwort, hinter dem sich nicht mehr und nicht weniger verbirgt als eine Neuformatierung unseres Gesundheitswesens aus dem Geiste der traditionellen Heilkunst. Das finde ich spannend. Ich muss nicht lange warten. Mein Gesprächspartner kommt zügigen Schrittes vom Dammtor-Bahnhof herüber. Sogleich nehmen mich seine wachen und munteren Augen gefangen, die wie kleine Diamanten aus seinem erstaunlich runden und kahlköpfigen Gesicht funkeln. »Schön, dass wir zusammen spazierengehen«, sagt er. Ich stimme zu, auch wenn ich etwas zögerlich bin: Das ist eine Premiere. Ich habe noch nie ein Interview im Gehen geführt. Aber es dauert nicht lange, bis mir klar wird, dass diese Premiere mit keinem anderen als mit Hartmut Schröder stattfinden konnte, sind doch für ihn Kultur und Natur aufs Engste verbunden.
Es ist ein frischer Frühlingsmorgen in Hamburg. Noch treibt ein kühler Wind ein paar flache Hochnebelfelder von der Küste her übers Land, doch arbeitet sich die Morgensonne tapfer vor und schickt ein paar wärmende Strahlen in die Parkanlage von Planten und Bloomen. Ich bin mit Hartmut Schröder verabredet, dem Mann, den ich am Vorabend noch bei einem Vortrag gehört hatte und dessen Vision mich begeistert hat: die Heraufkunft einer Kulturheilkunde – ein Zauberwort, hinter dem sich nicht mehr und nicht weniger verbirgt als eine Neuformatierung unseres Gesundheitswesens aus dem Geiste der traditionellen Heilkunst. Das finde ich spannend. Ich muss nicht lange warten. Mein Gesprächspartner kommt zügigen Schrittes vom Dammtor-Bahnhof herüber. Sogleich nehmen mich seine wachen und munteren Augen gefangen, die wie kleine Diamanten aus seinem erstaunlich runden und kahlköpfigen Gesicht funkeln. »Schön, dass wir zusammen spazierengehen«, sagt er. Ich stimme zu, auch wenn ich etwas zögerlich bin: Das ist eine Premiere. Ich habe noch nie ein Interview im Gehen geführt. Aber es dauert nicht lange, bis mir klar wird, dass diese Premiere mit keinem anderen als mit Hartmut Schröder stattfinden konnte, sind doch für ihn Kultur und Natur aufs Engste verbunden. Der Arzt der Zukunft ist ein Philosoph
Wir sind noch keine fünf Meter gegangen, da verblüfft er mich mit einem Zitat des amerikanischen Philosophen und Schriftstellers Ralph Waldo Trine, der vor mehr als hundert Jahren in seinem Bestseller »In Harmonie mit dem Unendlichen« einst die These vertreten habe, der Arzt der Zukunft werde ein »Philosoph und Lehrer«, dem es darum gehen werde, »den Menschen gesund zu erhalten und nicht erst wenn er krank geworden ist seine Heilung zu versuchen«; was im Übrigen nicht neu sei, da auch in der europäischen Antike keine Grenze zwischen Heilkunst und Philosophie bestanden habe. Damals habe man noch ein klares Bewusstsein für die Verbindung von Natur und Kultur gehabt. Diesem Bewusstsein im heutigen Heilwesen zu einer Renaissance zu verhelfen, sei sein Anliegen. Wobei er »keine scharfe Trennlinie zwischen Natur und Kultur« sehe. Kulturheilkunde ziele auf die stimmige Verbindung von Geist und Natur um einer umfassenden Gesundheit willen.
Ich bitte ihn um ein Beispiel für die von ihm avisierte Kulturheilkunde, was er mit einem Hinweis auf das seit der Antike in Europa geläufige Badewesen beantwortet. Das Wasser – eigentlich ein Naturstoff – sei dort kulturell so eingebettet worden, dass es medizinische Bedeutung annehmen konnte. Erst in der Gegenwart sei diese Tradition abgerissen – »leider«, wie er betont. Denn die alten Badeorte seien in ihrer Verbindung von Medizin, Natur und Kultur echte Orte der Heilung gewesen. Genau das sollten sie wieder sein. Und nicht nur sie. Denn das heutige Gesundheitswesen im Ganzen ist in Schröders Wahrnehmung dringend reformbedürftig. Was gegenwärtig in Kliniken und Krankenhäusern geschehe, sei der Heilung der Patienten oft abträglich, weil Kultur und Natur schlechterdings ausgeblendet werden.
Natur heilt, Beton nicht
 Um diese These zu untermauern, verweist er auf Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten, laut denen es für die Heilungschancen eines Patienten ungleich besser ist, wenn er beim Blick aus dem Fenster in die Natur schaut und nicht auf eine Betonwand starren muss. Woraus man schließen könne, dass Raumgestaltung, Atmosphärik und kulturelle Prägung eines Ortes für das Heilungsgeschehen von hoher Relevanz sind. Hinzu kommen nach seiner Erfahrung soziale Faktoren, die ebenso unterstützend auf die Heilung einwirken können – oder, was leider auch geschieht – hemmend.
Um diese These zu untermauern, verweist er auf Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten, laut denen es für die Heilungschancen eines Patienten ungleich besser ist, wenn er beim Blick aus dem Fenster in die Natur schaut und nicht auf eine Betonwand starren muss. Woraus man schließen könne, dass Raumgestaltung, Atmosphärik und kulturelle Prägung eines Ortes für das Heilungsgeschehen von hoher Relevanz sind. Hinzu kommen nach seiner Erfahrung soziale Faktoren, die ebenso unterstützend auf die Heilung einwirken können – oder, was leider auch geschieht – hemmend. »Von entscheidender Bedeutung ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, vor allem wie wir mit einander reden«, erläutert Schröder. Man müsse zwar nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber es sei wichtig, sich dessen bewusst zu sein, »dass man mit nur einem Wort einen Menschen in einen völlig anderen Zustand versetzen kann – im Guten wie im Bösen«. Die Sprache, so seine Überzeugung, wird als Therapeutikum weitgehend unterschätzt. Das sei in der von ihm vorgeschlagenen Kulturheilkunde ganz anders.
Von der Linguistik zur Heilkunde
Gerne erzählt Schröder in diesem Zusammenhang von Antiphon von Athen, einem antiken Arzt, den Paul Watzlawick als Gründer dessen feierte, was er eine »somatische Rhetorik« nannte: eine Redekunst, die über die Sprache auf die Physiologie der Menschen einzuwirken wusste. Das Thema scheint Schröder zu begeistern. Ein markantes Funkeln spielt in seinen Augen, da er seinen Schritt unterbricht und sich mir zuwendet. »Antiphon«, erzählt er, »trat mit dem Anspruch auf, mit Mitteln der Sprache seine Patienten zu heilen. Und er hatte offenbar großen Erfolg damit.«
Die Bedeutung der Sprache für die Heilkunst zu ermitteln, ist wohl nicht zufällig Schröders Sternchenthema. Jedenfalls verrät ein Blick in die Vita des 60-Jährigen, dass er an der Viadrina-Universität in Frankfurt/Oder einen Lehrstuhl für Sprachgebrauch und Therapeutische Kommunikation innehat. Dabei ist die Sprachwissenschaft sein ursprüngliches Forschungsgebiet. Heilkunde und Medizin haben erst später sein Augenmerk auf sich gelenkt. Das interessiert mich: »Wie kommt ein Linguist dazu, sich mit Kulturheilkunde zu befassen?«, frage ich ihn – und staune nicht schlecht über seine offenherzige Antwort:
Die Macht der Worte habe ihn immer schon fasziniert. Vor allem, seit er sie am eigenen Leibe erfuhr: »Als 13-Jähriger litt ich unter einer sehr schweren Nierenerkrankung«, erinnert er sich, »die mich zu einem langen Klinikaufenthalt zwang. Dort wurde mir eine tiefgehende – man würde heute vielleicht sagen ›spirituelle‹ – Heilungserfahrung zuteil«, bei der ihm zugesprochene Worte eine zentrale Rolle spielten: »Ich war in einer Art Dialogsituation, wo etwas, das nicht aus mir kam, mir ganz klar sagte: ›Du bist gesund!‹ Das war wie ein Imperativ. Tatsächlich war ich von diesem Augenblick an geheilt – zur totalen Verblüffung meiner Ärzte.« Man kann sich vorstellen, dass diese Erfahrung Hartmut Schröder auf die Spur gesetzt hat, der heilenden Kraft der Sprache auf die Schliche kommen zu wollen.
Medizin ist nicht bloß Naturwissenschaft
»Sollten wir Rhetorik zum Pflichtfach im Medizinstudium machen«, möchte ich von ihm wissen. »Ja«, ist seine Antwort, der Studiengang heiße ja nicht umsonst »Humanmedizin«. Überhaupt sei er überzeugt, dass Medizin immer auch eine Geisteswissenschaft sei. »Medizin kann nie nur Naturwissenschaft sein.« – worüber sich aber nach seinem Eindruck auch die meisten konventionellen Mediziner einig seien. Das habe damit zu tun, dass Ärzte in ihrer alltäglichen Praxis gar nicht die Zeit haben, langwierige Forschungen über den
Zustand ihrer Patienten anzustellen, sondern oft spontan entscheiden müssen, was zu tun ist. Dabei könne die Wissenschaft nur bedingt helfen, denn Medizin definiere sich von einem Handlungsziel her, nicht von einem Erkenntnisziel. Es gebe aber in der modernen Medizin den aus Schröders Sicht problematischen Trend, alles hundertprozentig genau wissen zu wollen. Das führe dazu, dass Leitlinien und Nor-men aufgestellt werden, die zwar statistisch plausibel sind, auf den konkreten Patienten in einer konkreten Situation oft aber gar nicht angewendet werden können.
Mind over Medicine
 »Gesundheit«, sagt Schröder, »ist nicht etwas Äußeres, was sich quantifizieren lässt«. Wohl könne man bestimmte Werte ermitteln und Funktionen messen – den Blutdruck etwa oder bestimmte Blutwerte – aber das alles seien letztlich nur Anhaltspunkte für Störungen und Krankheiten, die von einem Arzt erst noch interpretiert werden müssen, bevor eine Diagnose erstellt werden kann. Das sei vor allem nötig, weil diese Werte in erheblichem Maß von inneren Faktoren und äußeren Reizen abhängen, wie die Forschung auf dem Feld der Psychoneuroimmunologie zeige. »Alles, was in uns geschieht, alles was von außen auf uns einwirkt, hat sofort für unsere Physiologie Bedeutung«, fasst er diesen Gedankengang zusammen. In dem neuen Paradigma »Mind over Medicine«, sei dies bereits gut auf die Formel gebracht worden.
»Gesundheit«, sagt Schröder, »ist nicht etwas Äußeres, was sich quantifizieren lässt«. Wohl könne man bestimmte Werte ermitteln und Funktionen messen – den Blutdruck etwa oder bestimmte Blutwerte – aber das alles seien letztlich nur Anhaltspunkte für Störungen und Krankheiten, die von einem Arzt erst noch interpretiert werden müssen, bevor eine Diagnose erstellt werden kann. Das sei vor allem nötig, weil diese Werte in erheblichem Maß von inneren Faktoren und äußeren Reizen abhängen, wie die Forschung auf dem Feld der Psychoneuroimmunologie zeige. »Alles, was in uns geschieht, alles was von außen auf uns einwirkt, hat sofort für unsere Physiologie Bedeutung«, fasst er diesen Gedankengang zusammen. In dem neuen Paradigma »Mind over Medicine«, sei dies bereits gut auf die Formel gebracht worden. Warum das so ist, kann Schröder gut plausibel machen. »Der Mensch ist ein Beziehungswesen«, sagt er, »und deshalb ist
es kein Wunder, dass sich nicht nur seine Psyche im Gegenüber zur Welt formt, sondern auch seine physische Verfassung durch seine Beziehungen geprägt ist.« Die Art und Weise, wie Menschen mit ihrer Umwelt kommunizieren und interagieren, sei aber wesentlich kulturell bestimmt, so dass auch von dieser Seite aus die Notwendigkeit einer Kulturheilkunde einsichtig ist: Wie bei der Sprache, so könne man von allen Formen der Kommunikation sagen, dass sie heilend oder auch verletzend sein könne. »Es ist ein leichtes, andere zu kränken«, sagt er. »Und durch Kränkung entsteht Krankheit«. Umgekehrt könne eine gute Beziehung Menschen stärken und heilen.
Heilung geschieht, wenn es stimmt
Gerade in der Kommunikation von Arzt und Patient sei das von entscheidender Wichtigkeit. Nicht zufällig spreche man
von dort von der »Passung«. »Wenn es zwischen beiden passt, wenn alles stimmt, dann ist Heilung möglich«, ist er überzeugt und verweist auf die Placebo-oder auch Nocebo-Forschung, die diesen Umstand belege. Nun kommt der Professor in ihm richtig in Schwung und ich muss zusehen, dass ich Schritt halten kann. »Der Arzt und der Patient«, sagt er, »bilden ein Resonanzsystem. Fühlt der Arzt sich überfordert oder geht er von der unausgesprochenen Annahme aus, für seinen Patienten nichts tun zu können, dann stimmt es nicht und die Heilung wird schwierig«.
Jedoch spiele noch ein dritter Faktor bei diesem kommunikativen Geschehen eine Rolle: das Wirkmittel. Dieses müsse nicht pharmakologischer Art sein. »Es kann das Messer sein oder allein ein Wort – der Gesang des Schamanen oder eine Pflanze.« Die hohe Kunst der Heilung bestehe darin, »diese drei Dinge so zur Übereinstimmung zu bringen, dass sich in ihrem Zusammenspiel etwas trifft – dass ein heilendes Feld entsteht«. Und dazu bedürfe es eben nicht großartiger wissenschaftlicher Anstrengungen, sondern nur der Resonanz von Patient, Heilmittel und Arzt. In diesem Augenblick huscht ein Eichhörnchen über den Weg und wir lächeln uns an: Resonanz.
Der Patient heilt mit
Die Bedeutung der Mitwirkung des Patienten beim Heilungsgeschehen wird nach Schröders Erfahrung meist unterschätzt. »Das Modell der naturwissenschaftlichen Medizin ist nicht nur das eines Reparaturbetriebes«, erklärt er,
»sondern es sieht für den Betroffenen auch keinerlei Eigenbeteiligung am Heilungsgeschehen vor.« Das sei bei der Kulturheilkunde radikal anders. Sie führe in die »Selbstwirksamkeit«: dahin, »dass der Einzelne zum Protagonisten seiner eigenen Heilung wird«.
»Beim Heilungsgeschehen«, ist Hartmut Schröder überzeugt, geht es »auf jeder Stufe um die stimmige Passung, um Achtsamkeit«. Dazu gehöre auch, dass der Patient spüre, welcher Arzt zu ihm passt. Habe er das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht oder fehle ihm Vertrauen zum Arzt, könne selbst bei bestem Spezialistentum das Feld nicht entstehen, das Heilung möglich macht. Familiäre Konflikte, Probleme bei der Arbeit,ebenso spirituelle Krisen können die Heilungsaussichten erheblich beeinträchtigen.
Nun ahne ich, warum Hartmut Schröder in dem von ihm und seiner Ehefrau gegründeten Therapeium in Berlin-Zehlendorf eine allgemeinmedizinische Praxis mit einer »eher psychiatrisch orientierten Praxis« verbunden hat, die freilich nicht mit Psychopharmaka, sondern orthomolekular arbeitet,
d.h. über die Ernährung den Patienten Hilfeleistung bietet. Neben dem ärztlichen Bereich kooperiert er auch mit Mentaltrainern und Coaches, um auf diese Weise ein möglichst umfassendes Angebotsspektrum für die Patienten vorhalten und der Komplexität des Lebens Rechnung tragen zu können.
Ein neues Paradigma entsteht
Hinzu kommt die Kooperation mit Heilkundigen aus anderen Kulturen. Ich möchte das genauer wissen und frage ihn, ob die traditionellen medizinischen Schulen ein wacheres Bewusstsein für die Komponente der Heilkunst hatten. Er bejaht dies und macht aus seiner Begeisterung für die Globalisierung der Medizin keinen Hehl – allerdings müsse sie anders vonstatten gehen als die ökonomische Globalisierung, bei der alles dem westlichen Denken unterworfen worden sei. »Wir können viel von traditionellen Medizinsystemen lernen«, ist er überzeugt. Das Gute an der Ethnomedizin sei, »dass dort Komponenten einbezogen werden, die in unserer Medizin in Vergessenheit geraten sind: Geist, Bewusstsein, Kultur«.
So sehr das Therapeium bei den Patienten auch Anklang findet, so viel Kritik musste sich Schröder für sein Modell eines innovativen Gesundheitswesens schon anhören. Dabei seien es weniger die Schulmediziner, derer Angriffe er sich zu erwehren habe, als viel mehr Vertreter von Randgruppen, die es meist aus ideologischen Gründen nicht ertragen können, wenn im Gesundheitswesen etwas Neues entsteht – etwas Fremdes, das sich nicht nahtlos ins Gefüge des herrschenden wissenschaftlich-medizinischen Paradigmen einzeichnen lässt. Besonders die sogenannten Wunderheilungen erregen nach seinem Eindruck vielerorts Unmut – und das obwohl die sogenannten Spontanremissionen bestens dokumentiert und bei näherer Betrachtung »eine alltägliche Erscheinung« seien.
Vision für Kur- und Badeorte
Schröder sieht in alledem Indizien dafür, dass gegenwärtig ein neues medizinischen Paradigma im Entstehen begriffen ist, das schon in naher Zukunft das Gesundheitswesen verändern wird. Der nächste Schritt, den er selbst in diese Richtung gehen möchte, ist das von ihm gemeinsam mit einem Philosophen entwickelte Konzept der »Kulturheiltage«, mittels dessen er den traditionellen Hotspots der Kulturheilkunst – den Kur-und Badeorten – zu neuem Leben verhelfen möchte. Dabei soll es darum gehen, für einige Tage im Jahr das Konzept »Kulturheilkunde« in Theorie und Praxis besser kennenzulernen.
Dass diese Vision auf großes Interesse stoßen wird, steht für ihn außer Frage. Und auch wenn er selbst sagt, es sei vielleicht »naiv« solches zu erwarten, verspricht er sich von dem erhofften Erfolg der »Kulturheiltage« auch ein Signal an die Politik, der auf diese Weise das Patienteninteresse vermittelt werden könne. Vor allem werde es zeigen, dass die Kulturheilkunde nun gerade nicht zu einer weiteren Kostenexplosion im Gesundheitswesen führen werde, sondern im Gegenteil eher zur Kostendämpfung beträgt; und das bei einer gleichzeitigen Qualitätssteigerung der Gesundheitsversorgung – so nämlich, »dass es wieder stimmt«, wie Schröder gerne sagt.
Kultur heilen
Teilt man Schröders Vision einer gesellschaftlichen Verankerung der Kulturheilkunde, bekommt das Konzept einen weiteren Klang. Dann nämlich verweist es nicht allein auf die Heilkraft der Kultur, sondern auch auf das in dieser Art der Heilkunde angelegte Potenzial, die Wunden unserer Kultur zu heilen. »Kulturheilkunde bedeutet nicht nur, dass man mit Hilfe von Kultur die Krankheiten Einzelner heilt, nein, es bedeutet auch, dass unsere Kultur von ihrer Entfremdung von der Natur geheilt wird – dass Mutter Erde uns das wieder geben kann, was von Natur aus vorgesehen ist.«
Unser Spaziergang neigt sich dem Ende. Wir stehen auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Welt, so könnte man sagen, hat uns wieder. Und vielleicht ist das ja der Grund dafür, warum mein Gegenüber abschließend auf diejenigen Trends der Gegenwart zu sprechen kommt, die ihn beunruhigen – und auf die er mit seiner Vision der Kulturheilkunde reagieren will: »Human Enhancement« und »Transhumanismus«, die derzeit in den USA mit dem Versprechen auftreten, die Menschheit einer neuen Entwicklungsstufe zuzuführen, schmecken ihm gar nicht. Gehe es dort um die technische Perfektionierung des Menschen und folglich um eine fortgeschrittene Entfremdung von der Natur, so schlage die Kulturheilkunde die Brücke zur Natur und vertraue auf die ihr innewohnenden Selbstheilungskräfte.
 Gerade weil sich die Kulturheilkunde passgenau mit Schulmedizin und anderen, komplementären medizinischen Systemen wie Ethnomedizin oder Naturheilkunde verbinden lässt, erscheint sie ihm als vielsprechender Gegenentwurf zu den transhumanistischen Verheißungen: als eine wahrhaft humanistische Medizin, die Ernst macht mit der Idee, das Wohlergehen des Menschen als höchsten Wert des Gesundheitswesens zu achten: »als Medizin für den Menschen 3.0 – den Menschen, der ein soziales Wesen mit Geist und Bewusstsein ist, und der kraft seiner Kultur ein heilendes und gesundes Umfeld für sich zu schaffen vermag.«
Gerade weil sich die Kulturheilkunde passgenau mit Schulmedizin und anderen, komplementären medizinischen Systemen wie Ethnomedizin oder Naturheilkunde verbinden lässt, erscheint sie ihm als vielsprechender Gegenentwurf zu den transhumanistischen Verheißungen: als eine wahrhaft humanistische Medizin, die Ernst macht mit der Idee, das Wohlergehen des Menschen als höchsten Wert des Gesundheitswesens zu achten: »als Medizin für den Menschen 3.0 – den Menschen, der ein soziales Wesen mit Geist und Bewusstsein ist, und der kraft seiner Kultur ein heilendes und gesundes Umfeld für sich zu schaffen vermag.« Prof. Hartmut Schröder
Prof. Hartmut Schröder geht seiner Vision einer Heilkunst der Zukunft auf vielfältige Weise nach. Als Lehrstuhlinhaber an der Europa-Universität Viadrina lehrt und forscht er im Bereich Sprachgebrauch und Therapeutische Kommunikation. Dort hat er zudem das Institut für transkulturelle Gesundheitswissenschaften gegründet. Außerdem ist er Direktor des Steinbeis-Transfer-Instituts für Therapeutische Kommunikation und Integrierte Gesundheitsförderung an der Steinbeis-Hochschule Berlin. Gemeinsam mit seiner Frau führt er in Berlin- Zehlendorf das »Therapeium – Zentrum für Natur-und Kulturheilkunde«. Und er ist Gesundheitscoach für Berlin-Mitte im Projekt »Gesunder Mittelstand« beim Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW). Aufgewachsen ist Schröder im Ruhrgebiet. Er promovierte in Linguistik an der Universität Bielefeld und war anschließend einige Jahre als Hochschullehrer in Skandinavien tätig. www.therapeium.de
Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 03/2015 - Jahr des Bodens erschienen.
Weitere Artikel von :
Kämpfer für das gute Leben
Christoph Quarch im Gespräch mit Alberto Acosta
Als Politiker hat Alberto Acosta die indigene Idee des »Buen Vivir« – des guten Lebens – in seiner Heimat Ecuador hoffähig gemacht. Heute streitet der Wirtschaftswissenschaftler dafür, weltweit die Rechte der Natur zu kodifizieren und fordert die »Entmarktung« der Gemeingüter.
Christoph Quarch im Gespräch mit Alberto Acosta
Als Politiker hat Alberto Acosta die indigene Idee des »Buen Vivir« – des guten Lebens – in seiner Heimat Ecuador hoffähig gemacht. Heute streitet der Wirtschaftswissenschaftler dafür, weltweit die Rechte der Natur zu kodifizieren und fordert die »Entmarktung« der Gemeingüter.
Lauter liebenswerte Lügen
Eindrücke von der EXPO Milano
Eindrücke von einem Tag auf der Weltausstellung zum Thema »Ernährung und Energie« in Mailand
Eindrücke von der EXPO Milano
Eindrücke von einem Tag auf der Weltausstellung zum Thema »Ernährung und Energie« in Mailand
Projekte für den Wandel
Nicht tatenlos zuschauen!
Der Philosoph Christoph Quarch und der Archäologe Wolfgang Hautumm starten die Kampagne »Wir helfen Hellas«.
Nicht tatenlos zuschauen!
Der Philosoph Christoph Quarch und der Archäologe Wolfgang Hautumm starten die Kampagne »Wir helfen Hellas«.
Die Erde ehren
Der Schweizer "evolutant" Sesto Castagnoli ist einer der ersten Unterstützer der Fuji Deklaration in Europa.
Ein Interview des forum Autors Christoph Quarch mit dem Schweizer Aktivisten Sesto Castagnoli über die Besonderheiten der Fuji-Deklaration.
Der Schweizer "evolutant" Sesto Castagnoli ist einer der ersten Unterstützer der Fuji Deklaration in Europa.
Ein Interview des forum Autors Christoph Quarch mit dem Schweizer Aktivisten Sesto Castagnoli über die Besonderheiten der Fuji-Deklaration.
Ohne Schönheit wird das nichts
Der Holländer Jan Teunen ist ein Cultural Capital Producer, er entwickelt für seine Kunden eine neue bereichernde Unternehmenskultur.
Nur eine intakte Unternehmenskultur kann Menschen dazu inspirieren, das Beste aus sich herauszuholen und das in einer Firma schlummernde Potenzial zu entfalten.
Der Holländer Jan Teunen ist ein Cultural Capital Producer, er entwickelt für seine Kunden eine neue bereichernde Unternehmenskultur.
Nur eine intakte Unternehmenskultur kann Menschen dazu inspirieren, das Beste aus sich herauszuholen und das in einer Firma schlummernde Potenzial zu entfalten.

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy
forum 01/2026
- Zukunft bauen
- Frieden kultivieren
- Moor rockt!
Kaufen...
Abonnieren...
04
FEB
2026
FEB
2026
Solarenergie, Großspeicher und Netzausbau – aber keine Gaskraftwerke!
Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"
80336 München und online
Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"
80336 München und online
10
FEB
2026
FEB
2026
11
FEB
2026
FEB
2026
BootCamp Impact Business Design
Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills
81371 München
Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills
81371 München
Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Megatrends
 Eine Zeit der "Sinnfinsternis"
Eine Zeit der "Sinnfinsternis"Ein Blick auf die neuen Zahlen zur Kindswohlgefährdung macht auch den Philosophen Christoph Quarch sprachlos
Jetzt auf forum:
Rat für Nachhaltige Entwicklung neu berufen
Sperrmüll vs. Entrümpelungsfirma: Wann lohnt sich professionelle Hilfe?
Das große Aufwachen nach Davos
BAUExpo 2026 vom 20. bis 22. Februar in Gießen
Lichtblicke für die Landwirtschaft: Nachhaltige LED-Technologien im Einsatz