„Die Wissenschaft denkt nicht!“
Christoph Quarch plädiert dafür, in der Pandemie auf die Wissenschaft zu setzen, aber auch den Diskurs darüber zu führen, was diese antreibt.
Das dritte Jahr mit Covid hat begonnen und die Infektionszahlen steigen in nie gekannte Höhen. Und das, obwohl Millionen Menschen geimpft oder geboostert sind und Milliardengelder in Forschungsprojekte für Impfstoffe oder Medikamente investiert wurden. Das Virus, so könnte man glauben, treibt gleichwohl seinen Schabernack mit uns. Vor allem wirft es uns dieser Tage eine verstörende Frage vor: Ist unsere Wissenschaft wirklich in der Lage, dem Erreger beizukommen? Ist Wissenschaft wirklich die einzige Waffe im Kampf gegen Corona, wie der ZDF-Wissenschaftsjournalist Ingolf Baur dieser Tage behauptet hat? Oder müssen wir akzeptieren, dass das Covid-Virus auch der Wissenschaft ihre Grenzen aufzeigt? Über diese Fragen reden wir mit unserem Philosophen Christoph Quarch.
Herr Quarch, wie steht es um Ihr Vertrauen in die Wissenschaft?
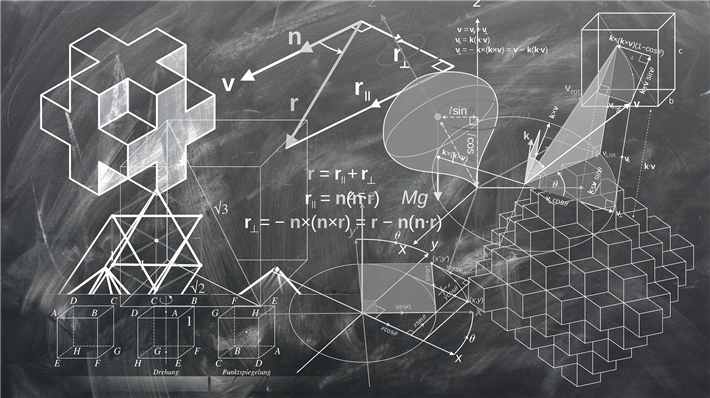 Ich weiß ehrlich gesagt
gar nicht, ob es „die Wissenschaft" gibt. Wenn in den Medien von „der
Wissenschaft" die Rede ist, dann sind damit meistens die empirischen und
angewandten „Naturwissenschaften" gemeint, denen wir in der Tat – gerade
in Zeiten der Pandemie – vieles zu verdanken haben. Es wird allerdings oft
übersehen, dass diese Wissenschaften im Verlaufe ihres Triumphzugs durch
die jüngere Geschichte auch eine Menge unliebsamer Nebenwirkungen
gezeitigt haben: von der Atombombe über die Umweltverschmutzung bis zum
Artensterben. Darauf hinzuweisen ist deshalb wichtig, weil daran ein
strukturelles Problem der neuzeitlichen Wissenschaft erkennbar wird: Sie
verschafft uns ein beispielloses Maß an Informationen, Daten und Wissen –
aber sie erzeugt aus sich heraus nicht die Weisheit, wie wir sinnvoll und
vernünftig damit umgehen.
Ich weiß ehrlich gesagt
gar nicht, ob es „die Wissenschaft" gibt. Wenn in den Medien von „der
Wissenschaft" die Rede ist, dann sind damit meistens die empirischen und
angewandten „Naturwissenschaften" gemeint, denen wir in der Tat – gerade
in Zeiten der Pandemie – vieles zu verdanken haben. Es wird allerdings oft
übersehen, dass diese Wissenschaften im Verlaufe ihres Triumphzugs durch
die jüngere Geschichte auch eine Menge unliebsamer Nebenwirkungen
gezeitigt haben: von der Atombombe über die Umweltverschmutzung bis zum
Artensterben. Darauf hinzuweisen ist deshalb wichtig, weil daran ein
strukturelles Problem der neuzeitlichen Wissenschaft erkennbar wird: Sie
verschafft uns ein beispielloses Maß an Informationen, Daten und Wissen –
aber sie erzeugt aus sich heraus nicht die Weisheit, wie wir sinnvoll und
vernünftig damit umgehen.
Aber man kann der Wissenschaft doch nicht ankreiden, dass
ihre Erkenntnisse missbraucht oder schlecht angewandt werden.
Nein, das kann man
nicht. Was man ihr allerdings durchaus ankreiden kann, ist der Hochmut
mancher Wissenschaftler, die sie zum einzig möglichen und erlaubten
Instrument unserer Weltwahrnehmung erklären – oder eben zur einzigen Waffe
gegen Corona, wie Herr Baur. Wobei ich schon die Wortwahl verräterisch
finde. Wissenschaft als Waffe – das lässt mich zusammenzucken, verrät aber
zugleich sehr viel über das Selbstverständnis vieler Wissenschaftler. Sie
verstehen ihre Wissenschaft als Instrument, um sich die Welt untertan zu
machen. Damit exekutieren sie ein Programm, das der Philosoph René
Descartes schon im 17. Jahrhundert formulierte, als er forderte, der
Mensch möge kraft seiner Wissenschaft zum Herrn und Meister über die Natur
werden; und zwar, um sie nach Maßgabe seiner Wünsche und Interessen
nutzbar zu machen oder gar zu verbessern.
Aber was ist falsch daran? Immerhin verdanken wir diesem
Wissenschaftsverständnis enorme zivilisatorische Fortschritte.
Falsch daran ist, dass
uns die Wissenschaft immer nur einen bestimmten Blick auf die Welt öffnet.
Sie ist nicht so objektiv, wie sie glaubt. Sie erkennt – wie die
Wissenschaftsphilosophie gezeigt hat – immer nur dasjenige, was dem
Erkenntnisinteresse der Forschenden folgt. Sie fragt überhaupt nur nach
demjenigen, was ihr fragwürdig erscheint. Sie selbst aber stellt sich
nicht die Frage, was von ihr befragt werden sollte und was nicht – oder anders
gesagt: Als Wissenschaft fragt die Wissenschaft nicht danach, warum
sie bestimmte Fragen stellt und andere nicht. Martin Heidegger hat deshalb
einmal die provozierende These formuliert: „Die Wissenschaft denkt nicht."
Er meinte damit: Sie denkt nicht über ihre Voraussetzungen nach. Das heißt
natürlich nicht, dass es nicht auch Wissenschaftler gäbe, die durchaus
nach dem Sinn ihres Tuns fragen. Aber wenn sie das tun, ist das eben nicht
mehr wissenschaftlich, sondern philosophisch oder religiös.
Okay, aber was heißt das jetzt in der Pandemie: Sollten wir
weiter auf die Wissenschaften setzen oder nicht?
Wir sollten auf die
Wissenschaft setzen, aber nicht nur auf sie. Genauso wichtig – und
das meine ich so, wie ich es sage – ist der Diskurs darüber, was die
Wissenschaft treibt: welchen Werten sie folgt, wem sie dienstbar ist,
wessen Interessen sie dient. All das muss gefragt werden, weil wir sonst
Gefahr laufen, die Wissenschaft zu ideologisieren. Und wenn gesagt wird,
sie sei die einzige Waffe im Kampf gegen Covid, dann ist genau das schon
passiert. Dann wird ungefragt ein Mindset propagiert, der erstens in einem
Denkmodell von Kampf und Krieg gefangen ist und dabei zweitens die
Wissenschaft als Heilmittel anpreist. Das hat aber nichts mehr mit Wissenschaft
zu tun, sondern mit Ideologie oder gar Religion. Und das ist gefährlich,
weil die Wissenschaft dadurch ihre Unschuld verliert und zu einer ganz
anderen Waffe wird: nämlich zur weltanschaulichen Waffe im Kampf gegen
eine Gruppe von vermeintlich unwissenschaftlichen oder irrationalen
Häretikern. Wo das geschieht, braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich
die Fronten in unserem Land immer mehr verhärten.


forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy
forum 01/2026
- Zukunft bauen
- Frieden kultivieren
- Moor rockt!
Kaufen...
Abonnieren...
JAN
2026
Impulse, Herausforderungen und Lösungswege
86159 Augsburg
FEB
2026
Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"
80336 München und online
FEB
2026
FEB
2026
Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills
81371 München
Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Politik
 Zeit - Ressource oder Kostenfaktor
Zeit - Ressource oder KostenfaktorChristoph Quarchs philosophischer Blick auf Reformstau und notwendige Investitionen in Infrastruktur und Innovationen
Jetzt auf forum:
Rat für Nachhaltige Entwicklung neu berufen
Sperrmüll vs. Entrümpelungsfirma: Wann lohnt sich professionelle Hilfe?
Das große Aufwachen nach Davos
BAUExpo 2026 vom 20. bis 22. Februar in Gießen
Lichtblicke für die Landwirtschaft: Nachhaltige LED-Technologien im Einsatz



















