Anja Bierwirth
Gesellschaft | Green Cities, 01.12.2020
Wandel der Stadtökonomie
Emissionsarm, klimaresilient und ressourcengerecht
Diesen Beitrag von Anja Bierwirth, Co-Leiterin des Forschungsbereichs „StadtWandel" am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, finden sie im B.A.U.M.-Jahrbuch 2020 - Nachhaltige Stadt. Unternehmen als Akteure im urbanen Raum.
Stadtentwicklung sieht sich heute sehr unterschiedlichen Herausforderungen ausgesetzt: Auf der einen Seite besteht ein wachsender Problemdruck durch ungleiche Entwicklungen von Wachstum und Schrumpfung, wirtschaftlichem Strukturwandel und Standortwettbewerb, Alterung der Gesellschaft, sozialer Ungleichheit und zunehmenden Umweltbelastungen und -risiken. Auf der anderen Seite bestehen wachsende Chancen, Wissen in Städten durch eine breite Mobilisierung aller Institutionen und Akteure für eine Vielfalt neuer Ansätze und Lösungen der Probleme nutzbar zu machen. Für eine moderne Nachhaltigkeits- und Innovationspolitik nimmt die Stadt- und Regionalebene als Aktionsraum somit eine Schlüsselrolle ein.
In diesem Spannungsfeld von steigendem Problemdruck und hohen Innovationspotenzialen bedarf es daher neuer forschungs- und wissensbasierter Politikansätze in der Stadt- und Regionalforschung, um Transformationspfade zur Nachhaltigkeit systematisch zu erschließen. Es bedarf allerdings auch einer kritisch-begleitenden Forschung im urbanen Raum, die eine Sensorik gegenwärtiger Prozesse gesellschaftlichen Wandels entwickelt und deren soziale wie ökologische Wirkungen auslotet. Ein solcher Ansatz bezieht seine stärksten Impulse und Orientierungen aus der internationalen politischen Debatte von den Sustainable Development Goals bis zu den Beschlüssen der UN-Klimakonferenz COP 21 in Paris. Konkret bietet insbesondere die New Urban Agenda (NUA) im Rahmen des UN-Habitat-Prozesses eine
Leitlinie, wie die UN Sustainable Development Goals (SDGs) und die Beschlüsse der UN-Klimakonferenz
im urbanen und regionalen Kontext wirkungsvoll umzusetzen sind. Insbesondere erhebt die NUA für
moderne Städte den Anspruch auf kompakte Siedlungsentwicklung mit angemessenen Freiräumen,
sparsamem Umgang mit Ressourcen, sozialem Ausgleich, klima- und umweltschonender sowie sozialverträglicher und sozial inkludierender Mobilität und Entwicklung gesunder Lebensbedingungen.
Den urbanen Wandel nachhaltig gestalten
Für einen gestalteten Wandel zur Nachhaltigkeit fehlen in Kommunen allerdings vielfach die Voraussetzungen: Kommunalverwaltungen sind von einer ressortspezifischen Problembearbeitung geprägt,
für übergreifende Handlungsansätze fehlen vielfach die Zuständigkeiten, Strukturen für einen fachbereichsübergreifenden Austausch und die notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Nicht
selten mangelt es auch an einem Bewusstsein für den Mehrwert und an der Bereitschaft, bestehende
Strukturen und Arbeitsabläufe zu verändern. Zukunftsthemen wie resiliente Infrastrukturentwicklungen,
nachhaltige Siedlungsentwicklung, Digitalisierung und nachhaltige Mobilität sind nur schwer in die
sektorale Struktur einer Verwaltung zu integrieren. Erschwerend führen die finanziellen Restriktionen
zu einer Reduzierung der Verwaltungstätigkeit auf so genannte Pflichtaufgaben und oftmals zu einer
deutlichen Reduktion des Dienstleistungsangebotes für die Bürgerinnen und Bürger – bei gleichzeitiger
Zunahme projektbasierter Ansätze auf der Basis von Drittmittelprojekten.
Trotz dieser spannungsreichen Rahmenbedingungen unternehmen viele Kommunen den Versuch einer
proaktiven Gestaltung urbanen Wandels zur Nachhaltigkeit. Unterlegt werden diese kommunalen Aktivitäten durch Initiativen, die nachhaltige Entwicklung in Quartieren befördern. Klimaquartiere, Urban
Gardening, Gemeinschaftsprojekte zur Energieversorgung, Sharing-Angebote, neue Nachbarschaften
etc. entsprechen vielfach den global formulierten Zielen zur nachhaltigen Entwicklung. Es gilt, diese
mit Ansätzen der Kommunalverwaltung zur Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Folgende normative
Zielkontexte bilden dabei den Ausgang:
- ... die dekarbonisierte Stadt - Klima ist ein schutzwürdiges Gut und die notwendige Dekarbonisierung setzt in zentralen Entwicklungsfeldern einer Stadt Innovationsprozesse zur Nachhaltigkeit frei: in Gebäuden und Quartieren, in Infrastrukturen (vor allem Energie und Verkehr) und im nachhaltigen Umgang mit Flächen.
- ... die klimaresiliente Stadt- Klimawandel birgt sowohl eine Risiko- als auch Entwicklungsdimension. Städte sind aufgrund ihrer Bevölkerungs- und baulichen Dichte von Klimawandelfolgen wie z.B. Hitze- und Extremwetterereignissen betroffen. Eine klimaresiliente Stadt bewahrt trotz derartiger externer Störungen ihre Entwicklungsfähigkeit und setzt die Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger als zentralen Maßstab der Stadtentwicklung.
- ... die klima- und ressourcengerechte Stadt- Klima- und Ressourcengerechtigkeit unterteilen sich in eine soziale und eine politische Kategorie. Zum einen drücken sie ein demokratisches Moment aus, in dem es materieller und formaler demokratischer Strukturen bedarf, gerechte Stadtentwicklung zu ermöglichen. Zum anderen zielen soziale Innovationen in der klima- und ressourcengerechten Stadt darauf, die Beziehungen von Institutionen und Menschen untereinander zu verbessern. In einer klima- und ressourcengerechten Stadt ist der Zugang zu Umweltgütern (z.B. qualitätsvolle Stadträume), zu Energie (durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz) und zu Anpassungsmöglichkeiten an Klimafolgen integraler Teil der Daseinsvorsorge.
- ... die sozial und wirtschaftlich innovative Stadt- Soziale Innovationen sind ein Schlüssel, bestehende Handlungshemmnisse zu überwinden. Experimentelle Settings und Laborräume sind ein methodischer Ansatz, derartige Innovationen und regionalökonomische Wertschöpfung zu generieren.
Die vier genannten Zieldimensionen können mit dem Begriff der lebenswerten Stadt zusammengefasst
werden. Für ihre Ausgestaltung sind jedoch vielfältige Rückkopplungsprozesse notwendig, je nach
Stadttyp und Entwicklungsdynamik. Damit können abhängig von bestehenden Politik-, Akteurs- und
Unternehmensstrukturen, lokalen wissenschaftlichen Einrichtungen, naturräumlichen Rahmenbedingungen und sozialen Lagen unterschiedliche Auffassungen einer verbesserten Lebensqualität in
Städten aufkommen.
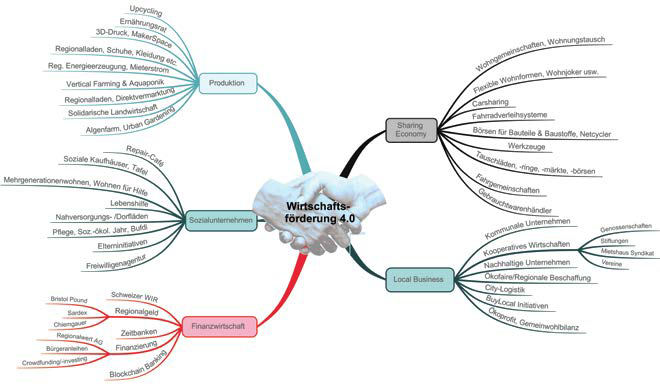
Wirtschaftsförderung 4.0
Wie soziale Fragen, regionalwirtschaftliche Aspekte und ökologische Belange einer Stadtökonomie
zusammengehen können, zeigt das Konzept der „Wirtschaftsförderung 4.0". Es betrachtet die gesamte
Wirtschaft und geht damit über die reine Unternehmensförderung – und damit die eher klassische
Wirtschaftsförderung – hinaus. Die „gesamte Wirtschaft" meint nicht nur bezahlte Tätigkeiten oder
geldbasierten Austausch. Sie umfasst sämtliche Tätigkeiten, die zur Herstellung, Nutzung, Entsorgung
und Wiederaufbereitung, zu Handel, Tausch, Kauf und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen notwendig sind. Sie umfasst außerdem den großen Bereich der unbezahlten Arbeit, wie die Betreuung
von Kindern, Pflege von Angehörigen oder ehrenamtliche Tätigkeiten, die mehr als die Hälfte aller
geleisteten Arbeit ausmachen. Viele lokale Initiativen tragen mit ihren innovativen Geschäftsmodellen zur
wirtschaftlichen Stabilität in einer Stadt, einer Region bei. Wie solche Initiativen und Geschäftsmodelle
gestärkt werden können, beschreibt und fördert das Konzept der „Wirtschaftsförderung 4.0", denn
ohne diese Formen der Wirtschaft könnte auch der gewerbliche Bereich nicht existieren.
Anja Bierwirth ist Co-Leiterin des Forschungsbereichs „StadtWandel" am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Als Architektin und Umweltwissenschaftlerin arbeitet sie schwerpunktmäßig im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung, Energieeffizienz und -suffizienz in Gebäuden.

forum future economy
forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy.
- Mit diesem Schritt markiert der Verlag bewusst eine Zeitenwende – hin zu einer Wirtschaft, die Zukunft schafft, statt nur Probleme zu verwalten.
Kaufen...
Abonnieren...
09
DEZ
2025
DEZ
2025
Club of Rome Salon: Building the City of the Future (in English)
Cities, World Expos, and Stakeholders Driving Sustainability
10178 Berlin
Cities, World Expos, and Stakeholders Driving Sustainability
10178 Berlin
Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Digitalisierung
 Smartphones und Philosophie
Smartphones und PhilosophieWerden Handy-Verbote in Schulen und Altersgrenze bei Social Media Nutzung die Probleme lösen?
Jetzt auf forum:
Song Contest "Dein Song für EINE WELT!"
Ökologische Stromproduktion aus Fließgewässern
Ab 14.12.2025 gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für 2026
Schulen stärken Bildung für nachhaltige Entwicklung
Seit 15 Jahren: faire und umweltbewusste Beschaffung mit dem Kompass Nachhaltigkeit















