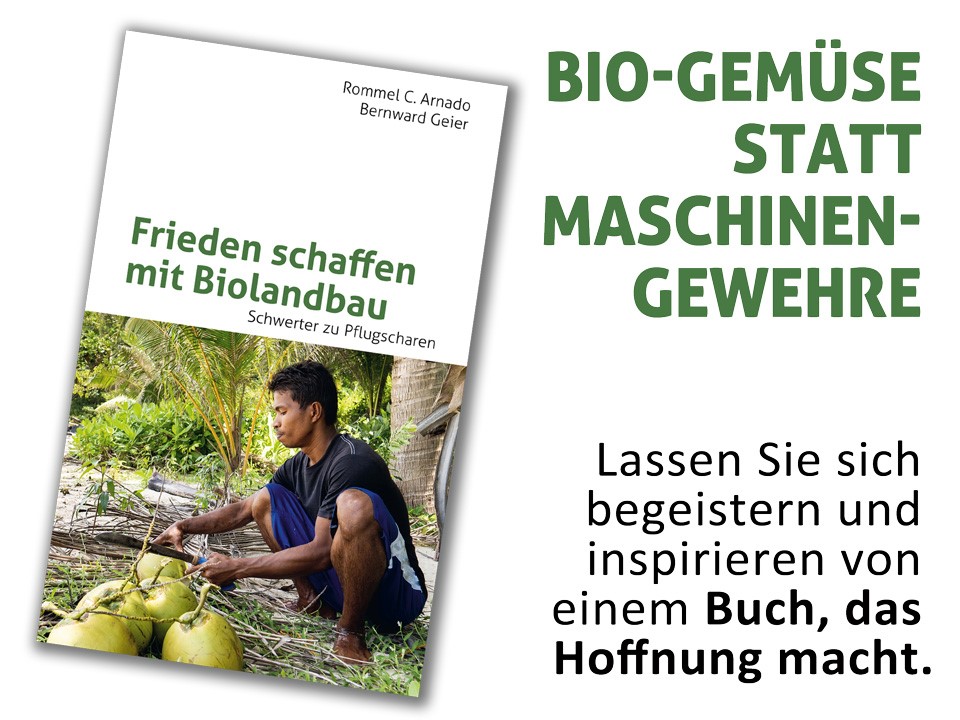Technik | Mobilität & Transport, 01.10.2007
Nachhaltige Mobilität in den Alpen
Vielfach wird von Politikern der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mit dem Argument vertreten, eine neue Straße stärke die regionale Entwicklung. Ist das wirklich so? Bringt eine neue Straße wirklich den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung? Gerade in den Alpen, wo es starke regionale Unterschiede im Erreichbarkeitsgefälle und starke Umweltbelastungen durch den Straßenverkehr gibt, ist diese Frage von besonderer Bedeutung.
Die Alpen: mitten in Europa und doch schlecht erreichbar?

Nicht überall sind die Alpen gut erschlossen.
Die Erreichbarkeit des Alpenraums ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsen; der Ausbau der Autobahnen und die Eröffnung neuer Tunnel haben dazu beigetragen. Die wirtschaftlichen Verflechtungen der Alpen mit anderen Räumen sind stark. Die Transeuropäischen Verkehrsprojekte der EU aber auch neue Flugverbindungen verbessern die Erreichbarkeit der Alpen kontinuierlich. Dennoch gibt es viele Regionen in den Alpen, wie zum Beispiel das Bündnerland oder das Wallis in der Schweiz, die schlecht erreichbar sind. Während also die Erreichbarkeit und die Durchlässigkeit der Alpen mittlerweile sehr gut ist, ist die innerregionale Erreichbarkeit in den Alpen relativ schlecht geblieben, in viele Seitentäler gelangt man nur über kurvige Straßen - vom öffentlichen Verkehr ganz zu schweigen. Die regionalen Unterschiede im Erreichbarkeitsgefälle in den Alpen haben sich sogar vergrößert - trotz laufenden Ausbaus der hochrangigen Verkehrsinfrastruktur oder auch gerade deswegen.
Gute Ereichbarkeit - ein Allheilmittel für Regionalentwicklung und wirtschaftliche Prosperität?
Die zehn reichsten Regionen in den Alpen gemessen am Bruttoregionalprodukt liegen im Hinblick auf die 3-Stunden-Einwohner-Erreichbarkeit nicht im Spitzenfeld der Alpenregionen. Auch gut erreichbare Alpenregionen stagnieren in ihrer Entwicklung. Im Tourismus ist die Erreichbarkeit außerdem zweitrangig. Von Innsbuck nach Ischgl braucht man fast anderthalb Stunden mit dem Auto - trotzdem ist die Gemeinde durch Paris-Hilton-Eventtourismus medial bekannt und gut besucht. Auch die Industrie nimmt längere Anfahrtswege in Kauf: etwa 20 Prozent der 250 Top-Industriebetriebe Österreichs haben ihre Produktions¬stätten und Werke nicht an hochrangigen Straßenverbindungen.
Es gibt also viele Regionen, die verkehrlich nicht so gut erschlossen sind, die aber touristisch florieren und wirtschaftlich stark sind. Im CIPRA-Wissenstransfer-Projekt "Zukunft in den Alpen" konnte festgestellt werden, dass sich eine Verbesserung der Erreichbarkeit in den Regionen situationsspezifisch sehr unterschiedlich auswirkt und in Zukunft eine noch größere Kluft zwischen bisher schon reichen und armen Regionen erzeugen kann. In abgelegeneren Regionen kann eine Verbesserung der Erreichbarkeit bedeuten, dass die regionale Wirtschaft einer stärkeren Konkurrenz und einem größeren Wettbewerb von Außen ausgesetzt ist. Welche positiven und negativen Verteilungseffekte eine neue Verkehrsinfrastruktur wirklich hat, lässt sich nicht verallgemeinern und ist von Region zu Region individuell zu beurteilen.
Zu einer starken Wirtschaft gehört also offenbar mehr als eine neue Straße oder ein neuer Autobahnanschluss. Der politische Wahlspruch, der Ausbau der Straßeninfrastruktur bringe eine stärkere regionale Wirtschaft, ist also nicht ganz richtig.
Erfolgreiche Alternativen für eine nachhaltige Mobilität

Die Vinschgauerbahn in Südtirol konnte erfolgreich revitalisiert werden - sicherlich eines der herausragenden positiven Beispiele für eine nachhaltige Mobilität in den Alpen.
Welche Alternativen gibt es also noch außer dem Straßenbau? Alternativen, die eine nachhaltige Mobilität für die Bevölkerung, für Arbeitspendler, den Tourismus und die Wirtschaft bieten. Im CIPRA-Projekt wurden alpenweit 52 sogenannte Best Practice Projekte der Sparte Mobilität untersucht. Viele davon zeigen, dass innovative Ideen, ein starker regionaler und politischer Wille erfolgversprechend sind. Ein herausragendes Projekt ist die Revitalisierung der Vinschgauerbahn in Südtirol, deren letzter Zug im Jahr 1990 fuhr. Ende der 1990er Jahre übernahm dann das Land Südtirol die Bahnstrecke von den Italienischen Staatsbahnen, die an der Strecke, die durch eine wunderschöne Apfellandschaft führt, kein Interesse mehr hatte.
Die neue Ära der Bahn ist schon von weitem sichtbar: modernes Rollmaterial, neue Brücken und moderne Haltestellen, die alten Bahnhöfe wurden als Relikte der Geschichte erhalten. An allen Stationen gibt es einen Fahrrad- und Mountainbike-Verleih. Das gesamte Tal kann mit dem Rad bequem befahren und erwandert werden - zurück zum Ausgangsort kommt man im Halbstundentakt. Aber nicht nur Urlauber benutzen die Bahn - auch Tagespendler sieht man mit ihren Aktentaschen morgens und abends in den Zügen.
Ein anderes Beispiel in weniger touristischen Gebieten, wie in Klaus in Oberösterreich oder Drôme in Frankreich, werden eigene, auf Freiwilligkeit beruhenden Fahrtendienste betrieben, die vor allem für ältere Menschen und Menschen ohne eigenes Auto von Interesse sind. Die Erreichbarkeit der zentralen Einrichtungen wie Post, Schule, Einkaufen wird dadurch erleichtert und für viele Menschen wieder ermöglicht.
Weitere Informationen im Internet:
http://www.cipra.org/de/zukunft-in-den-alpen
http://www.vinschgauerbahn.it
http://www.gemeinde-klaus.at
Abkürzungen:
CIPRA Commission Internationale pour la Protection des Alpes. Die CIPRA setzt sich seit einem halben Jahrhundert für die nachhaltige Entwicklung in den Alpen ein
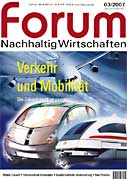 Dieser Text ist ein Beitrag für die 3. Ausgabe des Magazins "forum Nachhaltig Wirtschaften - Verkehr und Mobilität". Weitere Informationen zum Magazin finden Sie hier
Dieser Text ist ein Beitrag für die 3. Ausgabe des Magazins "forum Nachhaltig Wirtschaften - Verkehr und Mobilität". Weitere Informationen zum Magazin finden Sie hier
Die Alpen: mitten in Europa und doch schlecht erreichbar?

Nicht überall sind die Alpen gut erschlossen.
Foto: Quelle: Rosinak & Partner ZT GmbH
Die Erreichbarkeit des Alpenraums ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachsen; der Ausbau der Autobahnen und die Eröffnung neuer Tunnel haben dazu beigetragen. Die wirtschaftlichen Verflechtungen der Alpen mit anderen Räumen sind stark. Die Transeuropäischen Verkehrsprojekte der EU aber auch neue Flugverbindungen verbessern die Erreichbarkeit der Alpen kontinuierlich. Dennoch gibt es viele Regionen in den Alpen, wie zum Beispiel das Bündnerland oder das Wallis in der Schweiz, die schlecht erreichbar sind. Während also die Erreichbarkeit und die Durchlässigkeit der Alpen mittlerweile sehr gut ist, ist die innerregionale Erreichbarkeit in den Alpen relativ schlecht geblieben, in viele Seitentäler gelangt man nur über kurvige Straßen - vom öffentlichen Verkehr ganz zu schweigen. Die regionalen Unterschiede im Erreichbarkeitsgefälle in den Alpen haben sich sogar vergrößert - trotz laufenden Ausbaus der hochrangigen Verkehrsinfrastruktur oder auch gerade deswegen.
Gute Ereichbarkeit - ein Allheilmittel für Regionalentwicklung und wirtschaftliche Prosperität?
Die zehn reichsten Regionen in den Alpen gemessen am Bruttoregionalprodukt liegen im Hinblick auf die 3-Stunden-Einwohner-Erreichbarkeit nicht im Spitzenfeld der Alpenregionen. Auch gut erreichbare Alpenregionen stagnieren in ihrer Entwicklung. Im Tourismus ist die Erreichbarkeit außerdem zweitrangig. Von Innsbuck nach Ischgl braucht man fast anderthalb Stunden mit dem Auto - trotzdem ist die Gemeinde durch Paris-Hilton-Eventtourismus medial bekannt und gut besucht. Auch die Industrie nimmt längere Anfahrtswege in Kauf: etwa 20 Prozent der 250 Top-Industriebetriebe Österreichs haben ihre Produktions¬stätten und Werke nicht an hochrangigen Straßenverbindungen.
Es gibt also viele Regionen, die verkehrlich nicht so gut erschlossen sind, die aber touristisch florieren und wirtschaftlich stark sind. Im CIPRA-Wissenstransfer-Projekt "Zukunft in den Alpen" konnte festgestellt werden, dass sich eine Verbesserung der Erreichbarkeit in den Regionen situationsspezifisch sehr unterschiedlich auswirkt und in Zukunft eine noch größere Kluft zwischen bisher schon reichen und armen Regionen erzeugen kann. In abgelegeneren Regionen kann eine Verbesserung der Erreichbarkeit bedeuten, dass die regionale Wirtschaft einer stärkeren Konkurrenz und einem größeren Wettbewerb von Außen ausgesetzt ist. Welche positiven und negativen Verteilungseffekte eine neue Verkehrsinfrastruktur wirklich hat, lässt sich nicht verallgemeinern und ist von Region zu Region individuell zu beurteilen.
Zu einer starken Wirtschaft gehört also offenbar mehr als eine neue Straße oder ein neuer Autobahnanschluss. Der politische Wahlspruch, der Ausbau der Straßeninfrastruktur bringe eine stärkere regionale Wirtschaft, ist also nicht ganz richtig.
Erfolgreiche Alternativen für eine nachhaltige Mobilität

Die Vinschgauerbahn in Südtirol konnte erfolgreich revitalisiert werden - sicherlich eines der herausragenden positiven Beispiele für eine nachhaltige Mobilität in den Alpen.
Foto: Vinschgauerbahn, Autonome Provinz Südtirol
Welche Alternativen gibt es also noch außer dem Straßenbau? Alternativen, die eine nachhaltige Mobilität für die Bevölkerung, für Arbeitspendler, den Tourismus und die Wirtschaft bieten. Im CIPRA-Projekt wurden alpenweit 52 sogenannte Best Practice Projekte der Sparte Mobilität untersucht. Viele davon zeigen, dass innovative Ideen, ein starker regionaler und politischer Wille erfolgversprechend sind. Ein herausragendes Projekt ist die Revitalisierung der Vinschgauerbahn in Südtirol, deren letzter Zug im Jahr 1990 fuhr. Ende der 1990er Jahre übernahm dann das Land Südtirol die Bahnstrecke von den Italienischen Staatsbahnen, die an der Strecke, die durch eine wunderschöne Apfellandschaft führt, kein Interesse mehr hatte.
Die neue Ära der Bahn ist schon von weitem sichtbar: modernes Rollmaterial, neue Brücken und moderne Haltestellen, die alten Bahnhöfe wurden als Relikte der Geschichte erhalten. An allen Stationen gibt es einen Fahrrad- und Mountainbike-Verleih. Das gesamte Tal kann mit dem Rad bequem befahren und erwandert werden - zurück zum Ausgangsort kommt man im Halbstundentakt. Aber nicht nur Urlauber benutzen die Bahn - auch Tagespendler sieht man mit ihren Aktentaschen morgens und abends in den Zügen.
Ein anderes Beispiel in weniger touristischen Gebieten, wie in Klaus in Oberösterreich oder Drôme in Frankreich, werden eigene, auf Freiwilligkeit beruhenden Fahrtendienste betrieben, die vor allem für ältere Menschen und Menschen ohne eigenes Auto von Interesse sind. Die Erreichbarkeit der zentralen Einrichtungen wie Post, Schule, Einkaufen wird dadurch erleichtert und für viele Menschen wieder ermöglicht.
Die ersten Schritte zu einer nachhaltigen, intelligenten Mobilität sind getan - auch in den Alpen. Eine Internalisierung externer Kosten ist an der Zeit: zu einer nachhaltigen Mobilität ist es aber noch ein weiter Weg.
Von Andrea Weninger / Rosinak & Partner ZT GmbH (Wien)
http://www.cipra.org/de/zukunft-in-den-alpen
http://www.vinschgauerbahn.it
http://www.gemeinde-klaus.at
Abkürzungen:
CIPRA Commission Internationale pour la Protection des Alpes. Die CIPRA setzt sich seit einem halben Jahrhundert für die nachhaltige Entwicklung in den Alpen ein
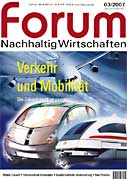 Dieser Text ist ein Beitrag für die 3. Ausgabe des Magazins "forum Nachhaltig Wirtschaften - Verkehr und Mobilität". Weitere Informationen zum Magazin finden Sie hier
Dieser Text ist ein Beitrag für die 3. Ausgabe des Magazins "forum Nachhaltig Wirtschaften - Verkehr und Mobilität". Weitere Informationen zum Magazin finden Sie hier
forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy
forum 01/2026
- Zukunft bauen
- Frieden kultivieren
- Moor rockt!
Kaufen...
Abonnieren...
04
FEB
2026
FEB
2026
Solarenergie, Großspeicher und Netzausbau – aber keine Gaskraftwerke!
Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"
80336 München und online
Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"
80336 München und online
10
FEB
2026
FEB
2026
11
FEB
2026
FEB
2026
BootCamp Impact Business Design
Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills
81371 München
Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills
81371 München
Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Megatrends
 Selbstgewählte Einsamkeit
Selbstgewählte EinsamkeitChristoph Quarch analysiert den Trend und empfiehlt, Komfortzonen zu verlassen
Jetzt auf forum:
Rat für Nachhaltige Entwicklung neu berufen
Sperrmüll vs. Entrümpelungsfirma: Wann lohnt sich professionelle Hilfe?
Das große Aufwachen nach Davos
BAUExpo 2026 vom 20. bis 22. Februar in Gießen
Lichtblicke für die Landwirtschaft: Nachhaltige LED-Technologien im Einsatz