Sabine Braun
Wirtschaft | Marketing & Kommunikation, 01.10.2007
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Feigenblatt oder Treiber?
Von Sabine Braun
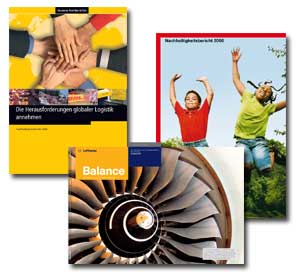 Über ein Drittel der 150 größten deutschen Unternehmen tut es. Unter den DAX30-Mitgliedern tun es sogar mehr als zwei Drittel: einen Nachhaltigkeits- oder CSR-Bericht veröffentlichen, der die Leistungen des Unternehmens für Umwelt und Gesellschaft darstellt.
Über ein Drittel der 150 größten deutschen Unternehmen tut es. Unter den DAX30-Mitgliedern tun es sogar mehr als zwei Drittel: einen Nachhaltigkeits- oder CSR-Bericht veröffentlichen, der die Leistungen des Unternehmens für Umwelt und Gesellschaft darstellt.
Nachhaltigkeitsberichterstattung gehört mittlerweile zum "guten Ton" und wird nicht nur von nachhaltigkeitsorientierten Rating Agenturen gewürdigt, sondern zunehmend auch von "konventionellen" Analysten und Investoren. Denn sie finden in Nachhaltigkeitsberichten wichtige Aussagen zu den Chancen und Risiken des Unternehmens, die ihnen die Beurteilung des künftigen Geschäftserfolgs erleichtern. Zu den Zielgruppen dieser Berichte zählen aber auch die eigenen Mitarbeiter, Behörden, Kunden und Lieferanten sowie Nichtregierungsorganisationen, die sich für ökologische und soziale Belange einsetzen.
Internationaler Trend
Was sich aus den ersten, Anfang der 1990er Jahre vor allem in Deutschland erschienen Ökobilanzen und Umweltberichten entwickelt hat, ist mittlerweile ein internationaler Trend. Im Jahr 2006 wurden weltweit knapp 2.300 Nachhaltigkeitsberichte publiziert, die meisten davon in Großbritannien, Japan, USA, Australien, Deutschland, Spanien und Italien. Auch in Brasilien, Südafrika und Neuseeland liegen inzwischen zahlreiche Berichte vor. Zur Ausbreitung dieser Praxis in Europa und weltweit haben die Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) entscheidend beitragen. Vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) gefördert, publizierte GRI 1998 erstmals Indikatoren, die ein guter Nachhaltigkeitsbericht enthalten sollte. Seit Oktober 2006 liegen sie in einer überarbeiteten dritten Fassung (G3) vor (www.globalreporting.org).
Von der UNEP unterstützt wird auch die Bewertung der Nachhaltigkeitsberichte, die SustainAbility alle zwei Jahre durchführt, um die weltweit besten 50 Reports zu identifizieren (www.sustainability.com). Einen umfassenden Kriterienkatalog haben future e.V. und das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung erarbeitet, um alle zwei Jahre die Qualität der Nachhaltigkeitsberichte aus den 150 größten deutschen Unternehmen zu bewerten. Die Ergebnisse des Rankings 2007, das vom Rat für Nachhaltige Entwicklung unterstützt wird, sollen im November 2007 veröffentlicht werden.
(www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de).
Glaubwürdigkeit ist zentral
Als zentrale Anforderungen an einen guten Nachhaltigkeitsbericht gelten Glaubwürdigkeit, Wesentlichkeit und Vollständigkeit. Die Berichte sollen nicht nur Erfolge darstellen, sondern auch Probleme und Schwachstellen, sich auf die wesentlichen ökologischen und sozialen Herausforderungen für das Unternehmen konzentrieren und trotzdem möglichst vollständig sein, sprich: keine Themen ausklammern.
Es klingt wie die Quadratur des Kreises und ist es vielfach auch. Denn die inhaltlichen Anforderungen der GRI sind umfassend und die oft unterschiedlichen Informationsansprüche der zentralen Stakeholdergruppen beziehen sich auch auf formale Aspekte: Mehr als 50 Seiten, meinen viele, dürfe ein Bericht nicht umfassen. Analysten und Investoren wünschen sich ein Management Summary und eine am Finanzmarkt orientierte Sprache, andere dagegen wollen lesenswerte Texte und mehr Details. In einem Punkt sind sich freilich alle einig: Offen und ehrlich sollen die Unternehmen berichten und nicht nur "die Rosinen herauspicken".
Treiber des Managements
Wie die vielfältigen Ansprüche am besten zu erfüllen sind, hängt auch von der jeweiligen Rezeptionskultur ab: In Spanien sind 200 Seiten lange Berichte keine Seltenheit, in Großbritannien sind sie dagegen knapp, aber mit kleiner Schrift dicht beschrieben. Zentrale Kennzahlen und ein aussagekräftiges Nachhaltigkeitsprogramm gelten jedoch überall als Standard - Letzteres lässt jedoch vielfach noch zu wünschen übrig. Und auch wenn sich die Unternehmen bislang mit selbstkritischen Äußerungen schwer tun, offenbaren die meisten in ihren Berichten doch zumindest den Willen zur Transparenz. Denn sie wissen, dass eine unglaubwürdige Berichterstattung ihnen letztlich mehr schadet als nützt. Selbst Wal-Mart legte den Entwurf seines ersten Umwelt- und Sozialberichts deshalb einem unabhängigen Berater vor, der ihn dann prompt als ungenügend einstufte.
Unbestritten stellen sich die Unternehmen mit der Erarbeitung eines Nachhaltigkeitsberichts einem schwierigen - angesichts der gesellschaftlichen Anforderungen aber auch zwingend notwendigen und irreversiblen Prozess. Einmal begonnen, bleibt lediglich der Weg der kontinuierlichen Verbesserung, denn ein Ausstieg wäre schmachvoll und das Eingeständnis mangelnden Transparenzwillens. Damit ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung in vielen Unternehmen zu einem zentralen Treiber des Managements geworden - ein Effekt, der von vielen Kritikern meist übersehen wird.
 Sabine Braun ist Gründerin und Geschäftsführerin von "akzente kommunikation und beratung gmbh", die sich seit 1993 auf Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation spezialisiert hat. Damit hat sie die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung deutscher Unternehmen seit den Anfängen begleitet und mitgeprägt. Sie ist überzeugt, dass "soziale, ökologische und ökonomische Anforderungen in einer demokratischen Marktwirtschaft zum Nutzen aller in Einklang zu bringen sind. Voraussetzung dafür ist eine offene und glaubwürdige Kommunikation, die ein gemeinsames Verständnis der Chancen und Risiken schafft." Sabine Braun war im Beirat der Lokalen Agenda 21 München und ist seit 1995 im Vorstand von future e.V., einer 1986 gegründeten Umweltinitiative von Unternehmen.
Sabine Braun ist Gründerin und Geschäftsführerin von "akzente kommunikation und beratung gmbh", die sich seit 1993 auf Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation spezialisiert hat. Damit hat sie die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung deutscher Unternehmen seit den Anfängen begleitet und mitgeprägt. Sie ist überzeugt, dass "soziale, ökologische und ökonomische Anforderungen in einer demokratischen Marktwirtschaft zum Nutzen aller in Einklang zu bringen sind. Voraussetzung dafür ist eine offene und glaubwürdige Kommunikation, die ein gemeinsames Verständnis der Chancen und Risiken schafft." Sabine Braun war im Beirat der Lokalen Agenda 21 München und ist seit 1995 im Vorstand von future e.V., einer 1986 gegründeten Umweltinitiative von Unternehmen.
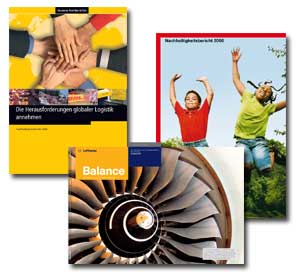 Über ein Drittel der 150 größten deutschen Unternehmen tut es. Unter den DAX30-Mitgliedern tun es sogar mehr als zwei Drittel: einen Nachhaltigkeits- oder CSR-Bericht veröffentlichen, der die Leistungen des Unternehmens für Umwelt und Gesellschaft darstellt.
Über ein Drittel der 150 größten deutschen Unternehmen tut es. Unter den DAX30-Mitgliedern tun es sogar mehr als zwei Drittel: einen Nachhaltigkeits- oder CSR-Bericht veröffentlichen, der die Leistungen des Unternehmens für Umwelt und Gesellschaft darstellt. Nachhaltigkeitsberichterstattung gehört mittlerweile zum "guten Ton" und wird nicht nur von nachhaltigkeitsorientierten Rating Agenturen gewürdigt, sondern zunehmend auch von "konventionellen" Analysten und Investoren. Denn sie finden in Nachhaltigkeitsberichten wichtige Aussagen zu den Chancen und Risiken des Unternehmens, die ihnen die Beurteilung des künftigen Geschäftserfolgs erleichtern. Zu den Zielgruppen dieser Berichte zählen aber auch die eigenen Mitarbeiter, Behörden, Kunden und Lieferanten sowie Nichtregierungsorganisationen, die sich für ökologische und soziale Belange einsetzen.
Internationaler Trend
Was sich aus den ersten, Anfang der 1990er Jahre vor allem in Deutschland erschienen Ökobilanzen und Umweltberichten entwickelt hat, ist mittlerweile ein internationaler Trend. Im Jahr 2006 wurden weltweit knapp 2.300 Nachhaltigkeitsberichte publiziert, die meisten davon in Großbritannien, Japan, USA, Australien, Deutschland, Spanien und Italien. Auch in Brasilien, Südafrika und Neuseeland liegen inzwischen zahlreiche Berichte vor. Zur Ausbreitung dieser Praxis in Europa und weltweit haben die Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) entscheidend beitragen. Vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) gefördert, publizierte GRI 1998 erstmals Indikatoren, die ein guter Nachhaltigkeitsbericht enthalten sollte. Seit Oktober 2006 liegen sie in einer überarbeiteten dritten Fassung (G3) vor (www.globalreporting.org).
Von der UNEP unterstützt wird auch die Bewertung der Nachhaltigkeitsberichte, die SustainAbility alle zwei Jahre durchführt, um die weltweit besten 50 Reports zu identifizieren (www.sustainability.com). Einen umfassenden Kriterienkatalog haben future e.V. und das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung erarbeitet, um alle zwei Jahre die Qualität der Nachhaltigkeitsberichte aus den 150 größten deutschen Unternehmen zu bewerten. Die Ergebnisse des Rankings 2007, das vom Rat für Nachhaltige Entwicklung unterstützt wird, sollen im November 2007 veröffentlicht werden.
(www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de).
Glaubwürdigkeit ist zentral
Als zentrale Anforderungen an einen guten Nachhaltigkeitsbericht gelten Glaubwürdigkeit, Wesentlichkeit und Vollständigkeit. Die Berichte sollen nicht nur Erfolge darstellen, sondern auch Probleme und Schwachstellen, sich auf die wesentlichen ökologischen und sozialen Herausforderungen für das Unternehmen konzentrieren und trotzdem möglichst vollständig sein, sprich: keine Themen ausklammern.
Es klingt wie die Quadratur des Kreises und ist es vielfach auch. Denn die inhaltlichen Anforderungen der GRI sind umfassend und die oft unterschiedlichen Informationsansprüche der zentralen Stakeholdergruppen beziehen sich auch auf formale Aspekte: Mehr als 50 Seiten, meinen viele, dürfe ein Bericht nicht umfassen. Analysten und Investoren wünschen sich ein Management Summary und eine am Finanzmarkt orientierte Sprache, andere dagegen wollen lesenswerte Texte und mehr Details. In einem Punkt sind sich freilich alle einig: Offen und ehrlich sollen die Unternehmen berichten und nicht nur "die Rosinen herauspicken".
Treiber des Managements
Wie die vielfältigen Ansprüche am besten zu erfüllen sind, hängt auch von der jeweiligen Rezeptionskultur ab: In Spanien sind 200 Seiten lange Berichte keine Seltenheit, in Großbritannien sind sie dagegen knapp, aber mit kleiner Schrift dicht beschrieben. Zentrale Kennzahlen und ein aussagekräftiges Nachhaltigkeitsprogramm gelten jedoch überall als Standard - Letzteres lässt jedoch vielfach noch zu wünschen übrig. Und auch wenn sich die Unternehmen bislang mit selbstkritischen Äußerungen schwer tun, offenbaren die meisten in ihren Berichten doch zumindest den Willen zur Transparenz. Denn sie wissen, dass eine unglaubwürdige Berichterstattung ihnen letztlich mehr schadet als nützt. Selbst Wal-Mart legte den Entwurf seines ersten Umwelt- und Sozialberichts deshalb einem unabhängigen Berater vor, der ihn dann prompt als ungenügend einstufte.
Unbestritten stellen sich die Unternehmen mit der Erarbeitung eines Nachhaltigkeitsberichts einem schwierigen - angesichts der gesellschaftlichen Anforderungen aber auch zwingend notwendigen und irreversiblen Prozess. Einmal begonnen, bleibt lediglich der Weg der kontinuierlichen Verbesserung, denn ein Ausstieg wäre schmachvoll und das Eingeständnis mangelnden Transparenzwillens. Damit ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung in vielen Unternehmen zu einem zentralen Treiber des Managements geworden - ein Effekt, der von vielen Kritikern meist übersehen wird.
Nachhaltigkeitsberichterstattung:  Empfehlungen für eine gute Unternehmenspraxis Empfehlungen für eine gute Unternehmenspraxis Einen knappen und übersichtlichen Leitfaden hat im März 2007 das Bundesumweltministerium (BMU) zum Thema veröffentlicht. Denn "Unternehmen, die glaubwürdig über die gesellschaftlichen Auswirkungen ihres wirtschaftlichen Handelns informieren, sichern sich die für den zukünftigen Geschäftserfolg notwendige Akzeptanz", so Bundesumweltminister Siegmar Gabriel. Die Broschüre steht als Download zur Verfügung unter: www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/downloads/doc/39166.php oder kann beim BMU bestellt werden: renate.heddergott@bmu.bund.de |
 Sabine Braun ist Gründerin und Geschäftsführerin von "akzente kommunikation und beratung gmbh", die sich seit 1993 auf Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation spezialisiert hat. Damit hat sie die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung deutscher Unternehmen seit den Anfängen begleitet und mitgeprägt. Sie ist überzeugt, dass "soziale, ökologische und ökonomische Anforderungen in einer demokratischen Marktwirtschaft zum Nutzen aller in Einklang zu bringen sind. Voraussetzung dafür ist eine offene und glaubwürdige Kommunikation, die ein gemeinsames Verständnis der Chancen und Risiken schafft." Sabine Braun war im Beirat der Lokalen Agenda 21 München und ist seit 1995 im Vorstand von future e.V., einer 1986 gegründeten Umweltinitiative von Unternehmen.
Sabine Braun ist Gründerin und Geschäftsführerin von "akzente kommunikation und beratung gmbh", die sich seit 1993 auf Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation spezialisiert hat. Damit hat sie die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung deutscher Unternehmen seit den Anfängen begleitet und mitgeprägt. Sie ist überzeugt, dass "soziale, ökologische und ökonomische Anforderungen in einer demokratischen Marktwirtschaft zum Nutzen aller in Einklang zu bringen sind. Voraussetzung dafür ist eine offene und glaubwürdige Kommunikation, die ein gemeinsames Verständnis der Chancen und Risiken schafft." Sabine Braun war im Beirat der Lokalen Agenda 21 München und ist seit 1995 im Vorstand von future e.V., einer 1986 gegründeten Umweltinitiative von Unternehmen.Weitere Artikel von Sabine Braun:
Die Welt nach Corona
Studien und Zukunftsperspektiven
Was kann die Welt aus Krisen lernen? Das wird zur entscheidenden Frage, wenn die Zeit der akuten Krisenbewältigung vorbei ist. Nachhaltigkeit könnte der Schlüssel für eine resilientere Wirtschaft sein, in der vorsorgender Naturschutz und angemessenes Wachstum keine Gegensätze sind.
Studien und Zukunftsperspektiven
Was kann die Welt aus Krisen lernen? Das wird zur entscheidenden Frage, wenn die Zeit der akuten Krisenbewältigung vorbei ist. Nachhaltigkeit könnte der Schlüssel für eine resilientere Wirtschaft sein, in der vorsorgender Naturschutz und angemessenes Wachstum keine Gegensätze sind.
Empowering Sustainable Solutions
Ein Bericht von GRI-Konferenz 2016 in Amsterdam
Die Frage, was Nachhaltigkeitsreporting bewirken kann, und die Hoffnung, mehr Transparenz möge zu nachhaltigeren Entscheidungen in Wirtschaft und Politik führen, prägten die 5. internationale Konferenz der Global Reporting Initiative in Amsterdam.
Ein Bericht von GRI-Konferenz 2016 in Amsterdam
Die Frage, was Nachhaltigkeitsreporting bewirken kann, und die Hoffnung, mehr Transparenz möge zu nachhaltigeren Entscheidungen in Wirtschaft und Politik führen, prägten die 5. internationale Konferenz der Global Reporting Initiative in Amsterdam.
Integrität | Arbeit in Deutschland | CDP Bericht | GRI Leitlinien
Sabine Braun zieht Bilanz aus Oktober/November 2013
Neue Studie: Unternehmenskultur hilft dabei, den Opportunismus als Handlungsmaxime zurückzudrängen. | Im Zuge der Mindestlohndebatte werden nun auch die Arbeitsbedingungen in Deutschland vertiefender betrachtet. | Vergangenen Mittwoch stellte das CDP bei der Jahreskonferenz in Frankfurt seinen aktuellen Bericht für DACH 350 vor. | Seit 12. November stehen die G4 Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative auch auf Deutsch zur Verfügung.
Sabine Braun zieht Bilanz aus Oktober/November 2013
Neue Studie: Unternehmenskultur hilft dabei, den Opportunismus als Handlungsmaxime zurückzudrängen. | Im Zuge der Mindestlohndebatte werden nun auch die Arbeitsbedingungen in Deutschland vertiefender betrachtet. | Vergangenen Mittwoch stellte das CDP bei der Jahreskonferenz in Frankfurt seinen aktuellen Bericht für DACH 350 vor. | Seit 12. November stehen die G4 Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative auch auf Deutsch zur Verfügung.
Ehrlich währt am längsten?
Sabine Braun zieht Bilanz aus dem CSR-Sommer 2013
Der Ehrliche ist zwar oft der Dumme. Aber nur auf kurze Frist. Mittel- und langfristig lohnt es sich auch für Unternehmen meistens, ehrlich zu sein. Das hat nun eine Studie bestätigt, die letztlich der Verbindung zwischen negativen Meldungen über das Unternehmensverhalten und der Entwicklung des Aktienkurses nachging.
Sabine Braun zieht Bilanz aus dem CSR-Sommer 2013
Der Ehrliche ist zwar oft der Dumme. Aber nur auf kurze Frist. Mittel- und langfristig lohnt es sich auch für Unternehmen meistens, ehrlich zu sein. Das hat nun eine Studie bestätigt, die letztlich der Verbindung zwischen negativen Meldungen über das Unternehmensverhalten und der Entwicklung des Aktienkurses nachging.
Deutsche wollen kein Wachstum um jeden Preis
Sabine Braun zieht Bilanz aus dem Sommer 2012
Die Reporting-Saison bricht an und überall werden Terminpläne fixiert, die schon jetzt eine gewisse Atemlosigkeit enthalten. Wir hoffen, dass sommerliche Gelassenheit uns alle noch eine Weile begleitet und starten in die "Saison" mit einem kleinen Rückblick auf wichtige Veröffentlichungen.
Sabine Braun zieht Bilanz aus dem Sommer 2012
Die Reporting-Saison bricht an und überall werden Terminpläne fixiert, die schon jetzt eine gewisse Atemlosigkeit enthalten. Wir hoffen, dass sommerliche Gelassenheit uns alle noch eine Weile begleitet und starten in die "Saison" mit einem kleinen Rückblick auf wichtige Veröffentlichungen.

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy
forum 01/2026
- Zukunft bauen
- Frieden kultivieren
- Moor rockt!
Kaufen...
Abonnieren...
30
JAN
2026
JAN
2026
Perspektive Wohnungsbau in Augsburg und Bayern
Impulse, Herausforderungen und Lösungswege
86159 Augsburg
Impulse, Herausforderungen und Lösungswege
86159 Augsburg
10
FEB
2026
FEB
2026
Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Gesundheit & Wellness
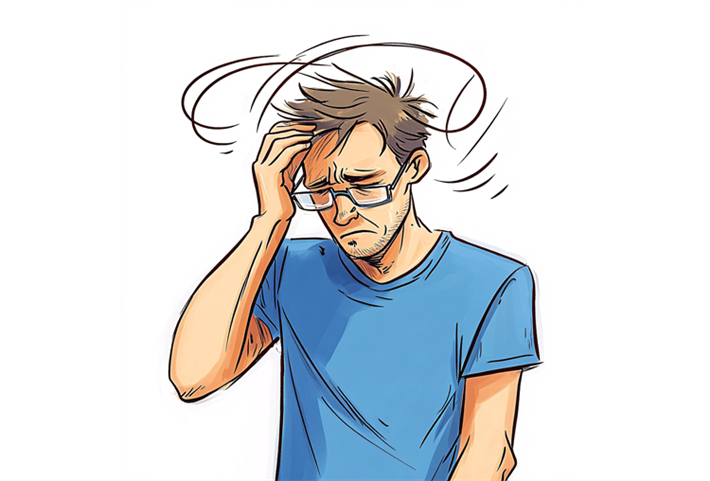 Krankheit und Gesundheit
Krankheit und GesundheitChristoph Quarch sieht die Stärkung der Resilienz als Weg zur Reduzierung der Krankenstände
Jetzt auf forum:
Rat für Nachhaltige Entwicklung neu berufen
Sperrmüll vs. Entrümpelungsfirma: Wann lohnt sich professionelle Hilfe?
BAUExpo 2026 vom 20. bis 22. Februar in Gießen
CO2-Preis: Bundesregierung sollte zu Koalitionsvertrag stehen


















