Wirtschaft | CSR & Strategie, 03.12.2007
Über wessen Verantwortung reden wir hier eigentlich?
 Wer immer von Unternehmen Verantwortung für diese, eine Welt fordert scheint nach meiner Beobachtung in guter Gesellschaft zu sein. Und darüber hinaus auch auf der richtigen Seite. Denn es reicht schon lange nicht mehr aus, wenn sich Unternehmen mit dem Verweis auf hohe Spenden für soziale oder ökologische Zwecke aus der Schlinge ziehen wollen. Die Forderungen gehen weiter: Sie es der Dialog mit den Stakeholdern, die modernen, transparenten Unternehmen ihre licence to operate erteilen. Oder die nicht wirklich neue, aber dennoch richtige Forderung, dass Unternehmensethik doch bitteschön im Kerngeschäft beginnen soll.
Wer immer von Unternehmen Verantwortung für diese, eine Welt fordert scheint nach meiner Beobachtung in guter Gesellschaft zu sein. Und darüber hinaus auch auf der richtigen Seite. Denn es reicht schon lange nicht mehr aus, wenn sich Unternehmen mit dem Verweis auf hohe Spenden für soziale oder ökologische Zwecke aus der Schlinge ziehen wollen. Die Forderungen gehen weiter: Sie es der Dialog mit den Stakeholdern, die modernen, transparenten Unternehmen ihre licence to operate erteilen. Oder die nicht wirklich neue, aber dennoch richtige Forderung, dass Unternehmensethik doch bitteschön im Kerngeschäft beginnen soll. Pathetisch gesprochen lässt sich festhalten: Unternehmen stehen in einer ganzheitlichen Verantwortung! Ganzheitlich, was das ganze Unternehmen angeht. Und ganzheitlich, was die ganze gobalisierte Welt angeht. Wo sich solche Forderungen Raum und Gehör schaffen, sind auch die passenden Begründungen nicht weit entfernt. So ist es zum Beispiel plausibel zu sagen, dass Unternehmen nicht im luftleeren Raum wirtschaften; folglich sollen sie auch für die Erhaltung dieses Raumes, mögen wir ihn Gesellschaft oder Natur nennen, verantwortlich sein. Und ebenso einfach ist es zu verstehen, dass Unternehmen aufgrund ihrer großen Macht, die sie in der Gesellschaft haben, in entsprechendem Maße für deren Mitgestaltung verantwortlich sind. Das Thema Nachhaltigkeit, und die etwas spezifischere, für die Managementsprache geschmeidigere Überschrift CSR, hat inzwischen die Köpfe der Menschen innerhalb und außerhalb der Unternehmen erreicht.
Bis hierhin, so könnte man sagen, zeichnen die Bemühungen derer, die sich für die Notwendigkeit der nachhaltigen Verantwortungsübernahme von Unternehmen und die Etablierung unternehmensethischen Denkens stark gemacht haben, deutliche Erfolge. Und ich bin sicher, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Doch nun müssen meines Erachtens komplementäre und vielleicht sogar viel dringendere Fragen stärker in den Blickpunkt rücken, nämlich: Wie ist es eigentlich um die Verantwortung für diese, eine Welt derer bestellt, die genau das von Unternehmen fordern? Wie steht es um die ethische Kompetenz der Stakeholdergruppen, denen gegenüber Unternehmen sich legitimieren sollen? Und nicht zuletzt, dafür aber umso pointierter gefragt: Wie steht es um die Verantwortung von uns beiden, von Ihnen, der bzw. die sie diesen Artikel gerade lesen und mir, der ich ihn geschrieben habe - seien wir nun Unternehmenslenker oder kritische Stakeholder?
Dualismus von Wirtschaft und Gesellschaft wird verfestigt
Mit der Forderung nach CSR wird meiner Meinung nach leicht ein klassicher Fehler gemacht, wenn auch unbewusst und in guter Absicht. Denn anstatt den oft implizit mitschwingenden Dualismus von Wirtschaft und Gesellschaft zu überwinden, unterstreicht man ihn nun von anderer Seite. Zwar erklärt man den Unternehmen, dass sie in der Gesellschaft und in der natürlichen Umwelt agieren, sich darin mit ihren Ressourcen versorgen und ihre Produkte absetzen, und deshalb logischerweise in keiner eigenen Sphäre existieren. Doch zugleich macht man als Fordernder - auch wenn man sich nun in einem mit den Unternehmen gemeinsamen Raum wähnt - zwei neue, von einander getrennte Schubladen auf.
Diese stellen sich, bildlich gesprochen, wie folgt dar: In der ersten Schublade sitzen die problembewussten und kritischen Forderer von CSR und Nachhaltigkeit. In der zweiten sitzen die egoistischen Unternehmen, an die die Forderungen gerichtet sind. Dabei gilt kurioserweise, dass die Bewohner der zweiten Schublade (die Unternehmen) nicht nur für ihre eigene, sondern auch noch für die erste Schublade verantwortlich sein sollen, wobei die Verantwortung der Bewohner der ersten Schublade (die Fordernden) sich allein darin manifestiert, dass sie von den Bewohnern der zweiten Schublade gleichsam die Verantwortung für den gesamten Schubladenschrank forden. In Klartext: Während die Unternehmen gefälligst alles zu verantworten haben, reicht es für die kritischen Stakeholder aus, ihre Forderungen an Unternehmen heranzutragen.
Zugegeben, dieses Bild ist wacklig und wirkt einigermaßen konstruiert. Dennoch ist es ein Fingerzeig auf unserer immer noch zu stark linear-mechanistisch strukturierendes Denken. Ein Denken, das dem hohen Lied der (wissenschaftlichen) Differenzierung, also der Unterscheidung oder auch Abgrenzung, folgt, anstatt - was bei solchen komplexen Herausforderungen, wie sie sich in der heutigen globalen Welt ergeben, das Bessere wäre - das Augenmerk auf die Eingebundenheit und Wechselwirkung Aller innerhalb eines allumfassenden Ganzen zu richten. Denn genau diese allumfassende Ganzheit ist es, was mit dem Ausdruck "diese, eine Welt" gemeint ist.
Wir alle sind folglich unumgänglich in dieses eine Ganze eingebunden und tragen unweigerlich, ob wir wollen oder nicht, zu seinem Gedeihen und Verderben bei. Es reicht für uns Individuen bei Weitem nicht aus, dass wir uns in den Chor derer gesellen, die von Unternehmen mehr CSR fordern. Vielmehr müssen wir uns fragen, wie wir das Schubladendenken überwinden und als Individuen unsere eigene "ganzheitliche" Verantwortung wahrnehmen können, ohne sie lautstark auf andere abzuwälzen. Doch just an diesem Punkt geraten wir in eine Zwickmühle. Denn aufgrund unserer Eingebundenheit in die Ganzheit der Welt, die sich nicht zuletzt durch die Wechselwirkungen der Ergebisse all unseren Handelns entwickelt, sind wir prinzipiell gar nicht in der Lage diese Welt zu beherrschen. Was uns bleibt, und wofür wir unmittelbar Verantwortung übernehmen können, ist die Rückbesinnung auf uns selbst - und damit auf die Reflexion unserer Werte, die unser Handeln leiten. Je mehr diese Werte - seien sie wissenschaftlich, religiös oder weltlich bzw. erfahrungsbasiert begründet - sich an der Bejahung und Entfaltung dieses einen Weltganzen sowie seiner es konstituierenden Teile ausrichten und im sich Handeln aktualisieren, desto besser werden wir auch unserer Verantwortung nachkommen können.
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung beginnen bei uns selbst
Die im Titel gestellte und im Text als komplementär zur CSR-Diskussion erklärte Frage "Über wessen Verantwortung reden wir eigentich?", kann nun eindeutig beantwortet werden: Über unsere eigene! Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung beginnen also bei uns selbst, nicht erst bei Unternehmen. Je gefestiger wir selbst in unseren Werten sind, desto stimmiger können wir diese in unseren unterschiedlichsten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rollen zum Ausdruck bringen. Egal, ob wir gerade als unternehmerische Führungskräfte, Konsumenten, ehrenamtliche Vertreter von Verbänden oder Vereinen, als Politiker oder schlicht als Privatpersonen auftreten.
Bezogen auf die Frage nach der Verantwortung von Unternehmen für diese, eine Welt scheint mir die erfolgsversprechendste Form eines nachhaltigen Wirtschaftens eine werteorientierte Unternehmensführung zu sein. Eine Unternehmensführung, die ihren begründeten Willen zur Verantwortungsübernahme und gesellschaftlichen Mitgestaltung (CSR) aktiv und stimmig in ihrem wirtschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Handeln zum Ausdruck bringt.
Von Matthias Schmidt
| Prof. Dr. Matthias Schmidt ist Vorstand der Klaus-Dieter-Trayser-Stiftung für werteorientierte Unternehmensführung (Kassel) und Geschäftsführer am Institut Unternehmensführung (Berlin und Kaiserslautern) www.klaus-dieter-trayser-stiftung.de www.institut-unternehmensfuehrung.de |
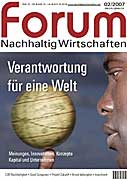 Dieser Text ist ein Beitrag zum Thema "Verantwortliches Handeln". Weitere spannende Beiträge zu diesem Themenkreis enthält das Magazin FORUM Nachhaltig Wirtschaften - Verantwortung für eine Welt. Bestellen Sie sich Ihr Exemplar oder abonnieren Sie das Magazin "Forum Nachhaltig Wirtschaften" zum Vorzugspreis. > hier
Dieser Text ist ein Beitrag zum Thema "Verantwortliches Handeln". Weitere spannende Beiträge zu diesem Themenkreis enthält das Magazin FORUM Nachhaltig Wirtschaften - Verantwortung für eine Welt. Bestellen Sie sich Ihr Exemplar oder abonnieren Sie das Magazin "Forum Nachhaltig Wirtschaften" zum Vorzugspreis. > hier
forum future economy
forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy.
- Zukunft bauen
- Frieden kultivieren
- Moor rockt!
Kaufen...
Abonnieren...
17
DEZ
2025
DEZ
2025
Lunch & Learn: Geschichten & Inspirationen zum Mitmachen
Impulse: Katrin Hansmeier, Basil Merk, Tina Teucher
online
Impulse: Katrin Hansmeier, Basil Merk, Tina Teucher
online
17
JAN
2026
JAN
2026
05
FEB
2026
FEB
2026
Konferenz des guten Wirtschaftens 2026
Veränderung willkommen? Wie Wandel gelingen kann
90475 Nürnberg
Veränderung willkommen? Wie Wandel gelingen kann
90475 Nürnberg
Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol
Megatrends
 Deutsche Einheit - deutsche Identität(en)
Deutsche Einheit - deutsche Identität(en)Christoph Quarch sieht die Zukunft in der Stärkung individueller Identitäten im Dialog mit anderen
Jetzt auf forum:
FNG-Siegel: 25 Fonds der Erste Asset Management mit Bestnote ausgezeichnet
So klappt's mit den Weihnachtsgeschenken – ohne Stress und Schulden
Deutschland hat kein Geldproblem, Deutschland hat ein Skill-Problem
Zuversicht und Inspiration schenken
Ab 14.12.2025 gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für 2026
Wie verbessern Skibrillen die Sicht und Sicherheit auf den Pisten















